Angewandte Ethik ausgearbeitet WS1819 PDF

| Title | Angewandte Ethik ausgearbeitet WS1819 |
|---|---|
| Course | Angewandte Ethik |
| Institution | Universität Graz |
| Pages | 9 |
| File Size | 187.3 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 100 |
| Total Views | 175 |
Summary
Download Angewandte Ethik ausgearbeitet WS1819 PDF
Description
Erläutern Sie die Unterscheidung von normativer Ethik, deskriptiver Ethik und Metaethik. Was ist jeweils Zielsetzung und Untersuchungsgegenstand? Normative Ethik: Die normative Ethik bewertet bestehende und entwirft eigene Moralsysteme. Ziel ist es herauszufinden, welche Moral die „richtige“ ist, und allgemein gültige Prinzipien zu bilden, die zu einem guten Leben für alle führen. Sie setzt sich selbst in ein Verhältnis zu bestehenden moralischen Systemen, z.B. den Moralvorstellungen von Religionen und Kulturen. Beispiel Todesstrafe: Entspricht in manchen Staaten dem nationalen Gesetz. Eine normative Ethik kann sich dazu positionieren und dagegenhalten, z.B.: „Töten ist grundsätzlich falsch, ohne Ausnahme.“ Sie argumentiert auch, z.B. in diesem Fall mit der Aussage, dass sich die Handlung des Tötens nicht rückgängig machen lässt. Deskriptive Ethik: Beschreibt bestehende moralische Systeme nur, ohne sie selbst zu bewerten. Untersucht werden Struktur und Inhalt von bestehenden Moralsystemen. Sie macht Aussagen darüber, welche Urteile ein moralisches System bildet und mit welcher Begründung. Beispiel Vegetarismus: „Tiere zu essen ist falsch, denn sie werden extra für diesen Zweck getötet.“ Die deskriptive Ethik stellt diese moralischen Werturteile lediglich fest, ohne sie selbst zu bewerten. Metaethik: Ziel ist es herauszufinden, wie moralische Werturteile zustande kommen, und welchen sprachlichen und logischen Charakter ethische Aussagen haben. Sie interessiert sich dafür, wie das Werturteil entsteht und nicht, was der Inhalt der moralischen Vorstellung ist.
Wo r i nu n t e r s c h e i de ns i c ha b s i c h t l i c h e s ,v or s ä t z l i c h e s ,f a h r l ä s s i g e sHa n d e l nu n d Un t e r l a s s e nu n dwi eh ä n g td i e smi tu n s e r e rVe r a n t wo r t u n gz u s a mme n ? Abs i c ht l i c he sHande l n:Be wus s t e sHa nd e l n ,de s s e nz ue r wa r t e nd e nFo l g e nv o r h e r g e s e he nu nd g e wo l l th e r b e i g e f üh r twe r d e n. Abs i c ht l i c he sHa nd e l ni mp l i z i e r tdi eSe l b s t z u s c hr e i bu n gv on Ha n dl un g s ma c ht :De rAkt e urwi l lni c htn ure i nbe s t i mmt e sZi e le r r e i c he nun dk e nn tdi eda f ür n öt i g e nMi t t e l ,s on de r nhä l ts i c hs e l bs ta uc hf ü rf ä hi g ,di ee nt s p r e c he nd e nMi t t e lz i e l f üh r e nd e i nz us e t z e n. Vo r s ä t z l i c he sHande l n:Wi l l e nt l i c he s ,d i ez ue r wa r t e nd e nHa nd l un g s f ol g e ndi r e kti nt e ndi e r e nd e s u ndpl a n v ol l e sHa nd e l n. De rAkt e urk e nn tdi eHa n dl un g s ums t ä nd eun ddi ev or h a nd e n e n Mö gl i c hk e i t e nun dha nd e l tp l a n v ol l , umbe s t i mmt eHa n dl un g s f ol g e nhe r be i z uf üh r e n . Fahr l äs s i g e sHande l n:Ni c ht e r f ül l un go b j e kt i vun v e r z i c ht ba r e rno r ma t i v e rVo r g a be nf ürdi e s a c hg e mä ßeDu r c hf üh r un ge i ne rTä t i gk e i t .Di en e g a t i v e nHa nd l un g s f ol g e ns i ndz wa rni c ht b e a b s i c ht i gt ,a be rpr i nz i pi e l l ,z . B.be ie nt s p r e c he nd e rAuf me r k s a mk e i t ,v or h e r s e hb a r .Er h e bl i c he Sc h ä d e n( f üra nd e r e )s i nddi eFo l g e nd e rNi c ht e r f ül l un gd e rSor gf a l t s p fli c ht .Al t e r n a t i v eun di nde r k on kr e t e nSi t ua t i o nz u mut b a r eHa nd l un g s mö gl i c hk e i t e nwä r e nv or h a nd e n .
Unt e r l a s s e n:Ni c h t a us f üh r e ne i ne rHa nd l un g ,di ei ne i ne rbe s t i mmt e nSi t ua t i onmor a l i s c hg e bo t e n u ndf ü rda sha nd e l nd eSub j e ktph y s i s c hr e a lmö gl i c hg e we s e nwä r e .Unt e r s c h e i du n gz umNi c ht Tun : Et wa sni c h tz ut unwi r dn urda nnz ue i ne rUn t e r l a s s u n g ,we nne i ne nt s p r e c he nd e sTunmor a l i s c h g e b ot e ng e we s e nwä r e .Be i s p i e l :Hi l f e l e i s t un gbe ie i ne mVe r k e h r s u nf a l l , ä r z t l i c heHi l f s p fli c ht . Ve r ant wor t unga l sUr h e be r s c ha f t( n i c ht be l i e bi g e rZus a mme nh a n ge i n e rPe r s onmi te i ne m Er e i gn i s )un dRe c he ns c ha f t( s i c hf ü re t wa sv e r a nt wo r t e n, Gr ü nd ene nn e n ,Ha nd l un gbe we r t e n) . Na c hd e md e rAkt e uri ne i ne mni c ht b e l i e b i g e nZus a mme nh a n gz ue i ne mEr e i gn i ss t e ht ,t r ä gte r a uc hdi eVe r a nt wo r t un gf ürdi eFo l g e ne i ne ra b s i c ht l i c he n ,v or s ä t z l i c he n, f a hr l ä s s i g e no de r u nt e r l a s s e ne nHa n dl un gu ndha tda r ü be rRe c he n s c ha f ta b z ul e g e n.
Welche Faktoren beeinflussen unsere Verantwortung und wie ist diese mit unseren Vorstellungen von Freiheit (Handlungs- und Willensfreiheit) sowie mit unseren Präferenzen (Motivation, Gründe) verbunden? Verantwortung als Urheberschaft (nicht-beliebiger Zusammenhang einer Person mit einem Ereignis) und Rechenschaft (sich für etwas verantworten, Gründe nennen, Handlung bewerten). Verantwortung gründet in der Freiheit; das Individuum kann also so handeln, wie es will, und wollen, was es will, dies bringt aber auch Verantwortung mit sich. Gerade die Handlungs- und Willensfreiheit halten uns oft davon ab so zu handeln, wie es moralisch angebracht wäre. Gründe: 1) Willensschwäche: Wir stimmen oft einem Moralurteil zu, ohne ihm im eigenen Handeln zu folgen, da die entsprechenden Handlungen nicht mit unseren persönlichen Präferenzen in Einklang zu bringen sind. Beispiel: Klimawandel. 2) Moralische Distanz: Räumliche und zeitliche Distanz in Hinblick auf die Akteure, denen gegenüber Handlungen oder Unterlassungen vorgesehen sind. Beispiel: eigene Angehörige im Erbrecht privilegiert. 3) Zeitpräferenz: steht dem Anspruch auf Allgemeingültigkeit moralischer Normen konträr entgegen.
Was unterscheidet Tatsachenaussagen und normative Aussagen? Was verstehen wir unter einem „naturalistischen Fehlschluss“? •Tatsachenaussagen (deskriptive Sätze) bringen zum Ausdruck, wie die Wirklichkeit nach einem bestimmten Ausschnitt beschaffen ist. •Normative Aussagen (präskriptive Sätze) bringen zum Ausdruck, wie die Wirklichkeit nach einem bestimmten Ausschnitt beschaffen sein sollte.
•Naturalistischer Fehlschluss: Aus einer Aussage, die beschreibt, wie es ist (deskriptive Aussage) wird eine normative Aussage (präskriptive Aussage) hergeleitet.
Ge b e nSi ee i n emö g l i c h s tp r ä g n a n t eBe s t i mmu n gd e rBe g r i ffeNo r m,Ma x i meu n d ( mo r a l i s c h e s )Pr i n z i p .Ch a r a kt e r i s i e r e nSi ed i eu n t e r s c h i e d l i c h e nEb e n e ni m Ra h me nn o r ma t i v e rBe g r ü n d u n g e n( v o nd e rTh e o r i eb i sz u ms i n g u l ä r e nUr t e i l ) . •Nor m:Ve r ha l t e ns v or s c hr i f t ,di eI nh a l te i ne spr ä s kr i pt i v e nSa t z e si s t( z . B.ni c htl ü g e n) .Nor me n s i ndRi c ht l i ni e n,d i ee i nHa nd e l nun t e rBe z u gn a hmea ufbe s t i mmt eWe r t ee nt we de r( a l ss e i n s o l l e nd )g e bi e t e nod e r( a l sn i c hts e i ns o l l e n d )v e r b i e t e n •Max i me :Le i t l i ni e( Re g e l ) , z ude r e nBe f o l gu n gs i c he i nHa nd e l nd e re nt s c hl i e ß t ,e i ns ub j e kt i v e r Vo r s a t zz urGe s t a l t un gd e se i g e n e ns i t t l i c he nLe be ns . •Mor al i s c he sPr i nz i p:v e r a l l g e me i ne r u n g s f ä hi g eHa nd l un gs ma xi me ,e i n ea l l g e me i n gü l t i g eRe g e l 1 )Ebe nede re t hi s c he nThe or i e n( o be r s t eMo r a l pr i nz i pi e n) ,2)Ebe nede re t h i s c he nPr i nz i pi e n ( Ei nh e i ts t i f t e nd ea l l g e me i neGr un ds ä t z e ) ,3 )Ebe nede re t hi s c he nNor me n( k on kr e t e , s i t ua t i on s s pe z i fis c heHa nd l un g s r e g e l n) ,4)Ebe nede rs i n gu l ä r e nUr t e i l e( no r ma t i v eAu s s a g e n b e z ü gl i c hk on kr e t e rHa n du n g s s i t ua t i on e n)
Wa ss i n dmo r a l i s c h eUr t e i l eu n dwa si s th i e ru n t e rAl l g e me i n g ü l t i g k e i t , Un i v e r s a l i s i e r b a r k e i tu n dUn p a r t e i l i c h k e i tz uv e r s t e h e n ? For ma l e sKe n nz e i c h e nmor a l i s c he rNor me n:Al l g e me i nh e i t ,Un i v e r s a l i s i e r ba r k e i t .Wa sf üre i ne Pe r s o nmor a l i s c hr i c h t i gi s t ,mu s sf ürj e dea nd e r ePe r s o ni ne i ne rv e r g l e i c h ba r e nSi t ua t i onmor a l i s c h r i c ht i gs e i n. Ma t e r i a l e sKe nnz e i c he nmor a l i s c h e rNor me n:un pa r t e i i s c he r , ob j e kt i v e rSt a nd pu nkt .Mo r a l i s c h r i c ht i gi s te i n eHa n dl un go de rNo r m,we nnda b e iv one i ne mu np a r t e i i s c he nSt a nd pu nk ta usd i e b e r e c h t i gt e nI nt e r e s s e nod e rda sWoh la l l e rBe t r o ffe ne ng l e i c h e r ma ße nb e r üc ks i c ht i gtwu r de n. Mor a l i s c heUr t e i l es i ndUr t e i l eü be rda sGut eun dRe c ht ede sHa nd e l ns . Si es t üt z e ns i c ha uf u ni v e r s e l l eGr u n ds ä t z eu nds i ndv e r i n ne r l i c ht( Ge f ü hld e rVe r pfli c ht u n g ,Ge f ü hlde rSc hu l dbe i Ve r s t o ß) .Nor ma t i v eUr t e i l es i ndun i v e r s e l l ,we i ls i e1 .e i ne nun i v e r s e l l e nGe l t un g s a n s pr uc he r he be n ( Al l g e me i n g ül t i g k e i t ) , un d2. Ha nd l un g e na us s c hl i e ßl i c ha u f gr un dv onFa kt or e nbe we r t e n ,di edu r c h Au s dr ü c k ev onl o gi s c ha l l g e me i ne rFor ma us g e dr ü c ktwe r de nun dn i c ht( a us s c hl i e ß l i c h)du r c h Ei g e nn a me n( Un i v e r s a l i s i e r ba r k e i t ) .Auß e r d e ms i nds i eo b j e kt i v( un p a r t e i i s c h) .
We l c h eFo l g e nk ö n n e na u sk o n s e q u e n t i a l i s t i s c h e rSi c h tn o r ma t i vr e l e v a n ts e i nu n d we l c h ePr o b l e ms t e l l u n g e ns i n dh i e r mi tv e r b u n d e n ? Konsequentialistisch bezeichnet alle Formen von Ethik, die die moralische Qualität von Handlungen von ihren Folgen abhängig machen, ob sie nun moralische oder nicht-moralische Qualitäten aufweisen. •f a kt i s c heFol g e ne i ne rHandl ung:Ve r s u c he i ne sTo ds c hl a g sod e rMo r d e swi r dwe ni g e rs t r e n g b e s t r a f ta l sde rv o l l e nd e t eTo ds c hl a go de rMo r d, a uc hwe nnz uf ä l l i g eun df ü rde nTä t e r u n v o r h e r s e hb a r eFa kt or e nd i eVo l l e nd un gde rTa tv e r h i nd e r th a b e n . •v om Akt e urbe a bs i c ht i g eHandl ung s f ol g e n:Pr o bl e mi s tdi eLe hr ev onde rDop pe l wi r ku n g . Ei neHa nd l un gha ts o woh le i negu t e , a l sa uc he i nes c hl e c h t eFo l g e .Si ei s tn urda nne r l a ub t ,we n n d e rAkt e urdi egu t e , ni c h ta be rdi es c hl e c ht eb e a b s i c ht i gtha t .Di es c h l e c ht eFol g eka nne i ne n i c ht b e a b s i c ht i gt eNe be nf ol g ea u sde rgu t e nFo l g es e i n .Da s sde rAkt e urs i ev o r a us s i e h t ,bl e i bt o hn eEi nflu s sa u fdi emor a l i s c h eQu a l i t ä ts e i ne rHa nd l u n g .Be i s p i e lSt e r be hi l f e( gu t eFo l g e Le i de ns mi n de r un g ,s c hl e c ht eFo l g eTo d) •v om Akt e urv or aus g e s e he neHa ndl ung s f ol g e n:Ve r me i d ba r e sUn wi s s e ns c hü t z tv orSt r a f e n i c ht .Abh ä n gi gv ond e ni nd i vi d ue l l e nun ds i t ua t i v e nMö gl i c hk e i t e n.
Er kl ä r e nSi ed i eUn t e r s c h e i d u n gz wi s c h e nPr i mä r -u n dSe ku n d ä r p r i n z i p i e nu n d wo z ud i e n td i e s ei mRa h me nk o n s e q u e n t i a l i s t i s c h e rPo s i t i o n e n ? Pr i mä r pr i nz i pi e ns i nddi ePr i nz i pi e nde re t hi s c he nTh e or i e ,wä hr e nddi eSe ku nd ä r pr i nz i pi e ndi e Pr i nz i p i e nde rs o z i a l e nPr a x i ss i nd .Di eUnt e r s c he i du n gz wi s c he nPr i mä r -un dSe kun dä r pr i nz i pi e n e r l a ubtde nAus we i s„ ul t i ma t i vgu t e r “Ha nd l un g e n ,di ea be rni c hte i nz uf or d e r ns i nd .Esgi bta l s o Ha n dl un g e nmi tgu t e n( a bs e hb a r e n)Fol g e n,we l c hee xa ktda sa u s f üh r e n, wa sv o nde n Pr i mä r pr i nz i pi e ng e f or d e r twi r d ,a be rdu r c hdi eSe ku nd ä r p r i nz i p i e nni c hte i n g e f o r de r twe r de n, um mor a l i s c heÜb e r f o r de r un gz uv e r me i de n. Di eUnt e r s c h e i d un gz wi s c he nPr i mä r -un d Se ku nd ä r p r i nz i pi e nl ä s s ts t a r k eAb we i c hu n g e nz wi s c he nde nI nh a l t e nde rSe kun dä r pr i nz i pi e n ( k on kr e t e r eVe r ha l t e ns n or me n)un dde nI n ha l t e nde rPr i mä r pr i nz i p i e n( o be r s t emo r a l i s c he Pr i nz i p i e n)z u .Pr ob l e m:f ü hr tb e idu r c h s c hn i t t l i c he nAkt e ur e nz uMi s s v e r s t ä n dn i s s e nmi tBl i c ka u f d i eBe gr ün du n gde rha nd l un g s a nl e i t e nd e nPr i nz i pi e n.
Was versteht man unter Utilitarismus und welche Probleme sind mit dieser Position verbunden? Beurteilung der Handlungsfolgen - Prinzip: „Handle immer so, dass das größtmögliche Maß an Nutzen (bzw. Glück) entsteht!“ (Maximum-Happiness-Principle). Das allgemeine Glück ergibt sich aus der Zusammenfassung des Glücks der einzelnen Menschen. Probleme: •Begünstigung von unmoralischem Verhalten: Das Zielkriterium (größtmöglicher Nutzen für alle) kann zu negativen Effekten führen (z.B. Bestechungsgelder zur Erhaltung von Arbeitsplätzen). •Quantifizierung: Kann alles quantifiziert werden? Lässt sich der Nutzen aus unterschiedlichen Gütern vergleichen, noch dazu in Hinsicht auf unterschiedliche Personen? •Probleme der Implementation: Um zu entscheiden, wie wir handeln sollen, müssen alle Alternativen detailliert untersucht werden. Angesichts der hierfür nötigen Menge an Information ist dies ohne weitgehende Annahmen unmöglich. Je nach Annahmen differieren die Ergebnisse.
Erläutern Sie die Unterscheidung zwischen Handlungs- und Regelutilitarismus und die sich hieraus ergebenden Probleme. • Handlungsutilitarismus analysiert die Konsequenzen jeder einzelnen Handlung und berechnet den Nutzen jedes Mal, wenn die Handlung ausgeführt wird/werden kann. Entscheidend ist: Welche guten und schlechten Folgen hat diese Handlung in dieser Situation? • Regelutilitarismus analysiert die wahrscheinlichen Folgen der Annahme (bzw. der sozialen Geltung) und der Befolgung von Regeln im Sinne von Sekundärprinzipien, die ausnahmslos Geltung beanspruchen. Entscheidend ist: Welche guten und schlechten Folgen hat, allgemein betrachtet, eine Handlung dieser Art in einer Situation dieser Art? Kritik: • In einzelnen Fällen kann der Handlungsutilitarismus die Verletzung wichtiger moralischer Regeln rechtfertigen und die Verletzung von Individualrechten als moralisch erforderlich ausweisen • Kann das Leid eines einzelnen Menschen durch die Lust eines anderen aufgerechnet werden?
Erklären Sie die Rolle der Autonomie in der Kantischen Ethik sowie die Unterscheidung zwischen hypothetischen und kategorischen Imperativen.
Autonomie ist das Prinzip eines Willens, der nicht durch fremde Gesetze, sondern durch sich selbst bestimmt wird und sein eigenes Gesetz unabhängig von Belohnungs- oder Bestrafungsmechanismen befolgt, die bei fremden Gesetzen nötig sind (da der Wille die Gesetze nicht um ihrer selbst willen will, muß er ja einen Anreiz dazu haben). Werden die Gesetze von den Objekten des Willens gegeben, so ist dieser heteronom bestimmt: Eine „ethische“ Handlung wird nicht um ihrer selbst willen, sondern zu einem bedingten Zweck vollzogen („ich soll etwas tun, weil ich etwas anderes will“), um etwas zu vermeiden oder zu erlangen, zum Beispiel, um glücklich zu werden. Der dazugehörige Imperativ ist bedingt (hypothetisch), da er nur eingeschränkt, nur auf diesen Zweck bezogen gültig ist, dessen Gewolltwerden von der Natur des Menschen abhängig, also kontingent ist; ein solcher Imperativ kann daher nicht Prinzip einer Moral sein, die ja für alle vernünftigen Wesen gelten soll. Damit wendet Kant sich gegen heteronome Ethiken wie zum Beispiel eine theologische Ethik, die Lohn beziehungsweise Strafe durch Gott ethischem Handeln zugrundelegt. Der autonome Mensch ist unabhängig von äußeren Autoritäten. Beim hypothetischen Imperativ ist man also moralisch nur an eine Handlungsweise gebunden, wenn man damit ein bestimmtes Ziel verfolgt. Beim kategorischen Imperativ ist moralisches Handeln nicht an eigene Ziele oder Wünsche gebunden, sondern soll universell gelten. Dennoch ist der Einzelne an der Definition moralischen Handelns beteiligt (also autonom), da er sich selbst fragen soll, ob sein Handeln als Vorbild für ein allgemeines Gesetz gelten kann.
Wie sind die unterschiedlichen Formen des kategorischen Imperativ bei Kant zu verstehen? Die erste Form ist ein rein formales Verfahren zur Überprüfung, ob eine vorgeschlagene Maxime moralisch zulässig ist. Die zweite und dritte Form setzen voraus, dass dem Mensch als „Person“ eine besondere Würde oder Fähigkeit zur Selbstgesetzgebung zukommt.
Erkläre den Unterschied zwischen deontologischer und teleologischer Ethik. Die teleologische Ethik geht als Konzept davon aus, dass sich Handlungen und jede Art von Entwicklungsprozessen an Zwecken orientieren und somit durchgängig zweckmäßig oder zielgerichtet ablaufen. Dabei stehen die Folgen des Handels im Mittelpunkt, also das Ergebnis des Handelns selbst. Beispiel Utilitarismus: Demnach ist all das gut, was „das größte Glück der größten Zahl“ – bezogen auf alle von einer Handlung betroffenen Menschen – hervorbringt. Bei der deontologischen Ethik wird das Handeln selbst betrachtet. Es geht also darum, wie eine Handlung, die einen Zweck erfüllen soll, hauptsächlich oder ausschließlich beschaffen ist. Die Handlung wird beurteilt und diese muss ethisch sein. Das Ergebnis ist zweitrangig. So bleibt zum
Beispiel eine Lüge, die verboten und unethisch ist, auch dann unethisch, selbst wenn durch die Lüge selbst eine noch größere Zahl von Lügen verhindert werden könnte.
Was sind Tugenden und wie kann man auf ihrer Grundlage Handlungen moralisch beurteilen? „Eine Tugend ist eine erworbene menschliche Eigenschaft, deren Besitz und Ausübung uns in die Lage versetzt, die Güter zu erreichen, die einer Praxis inhärent sind, und deren Fehlen wirksam verhindert, solche Güter zu erreichen.“ Lehre von der Tugend als goldenem Mittelweg zwischen einem Zuwenig und einem Zuviel, also zwischen zwei polar entgegengesetzten verderblichen Extremen. Soziale Tugenden (z.B. Umgänglichkeit) unterstützen in der Regel das moralisch richtige Handeln und werden zugleich auch um ihrer selbst willen geschätzt. Sekundärtugenden (z.B. Klugheit) unterstützen das moralisch richtige Handeln und werden nicht um ihrer selbst willen geschätzt. Problem: Auch tugendhafte Menschen können moralisch schlechte Handlungen begehen. Diese Handlungen werden dadurch nicht gerechtfertigter, dass sie von einem tugendhaften Menschen begangen werden.
Erläutern Sie die Unterscheidung zwischen Top-down-Modell und Bottom-upModell in der Angewandten Ethik. Im Top-down-Modell, das eher in der akademischen Welt beheimatet ist, werden die in der allgemeinen Ethik festgelegten Prinzipien auf konkrete Probleme angewandt. Die für gut und richtig befundene Handlung wird aus einem allgemeingültigen Prinzip für eine konkrete Situation abgeleitet. Diesem Verständnis liegt ein deduktives (ableitendes) Verständnis von Moral zu Grunde, nach dem eine moralische Handlungsregel immer zuerst allgemein begründet und erst dann im Hinblick auf die Besonderheiten der Situation angepasst wird. Das Modell sieht also für ein moralisches Urteil systematisch zunächst ab von konkreten Umständen. Gewonnen wird durch diese Praxisferne ein gut begründetes Moralprinzip, dessen Geltung im Prinzip nicht abhängig ist von konkreten Situationen und Veränderungen. Im Bottom-up-Modell werden Handlungsregeln und moralische Urteile nicht deduziert, sondern von unten nach oben induziert. Startpunkt sind konkrete, oft einzelhafte Situationen, in denen moralrelevante Problemlösungen und Aspekte identifiziert, gesammelt und systematisiert werden. Davon ausgehend werden dann Leitlinien des Handelns gewonnen, die auch für ähnliche andere Situationen hilfreich sein können. Dies erinnert an ein pragmatisches Problemlösen, wie es etwa in der Politik gebräuchlich ist. Das Modell nimmt also für ein moralisches Urteil zunächst die konkreten Situationen in den Blick. Gewonnen wird durch diesen Verzicht auf eine universale...
Similar Free PDFs

Vorlesungsfolien WS1819
- 21 Pages

Zusammenfassung TM3 WS1819
- 5 Pages

Ethik Zusammenfassung
- 3 Pages

Übungsklaussur Ethik
- 4 Pages

Humangeo 1 - Angewandte Geographie
- 12 Pages

Zusammenfassung Ethik
- 14 Pages

Referat Ethik
- 2 Pages

Angewandte Ökonometrie SET 1
- 7 Pages

Angewandte und Umweltmikrobiologie
- 36 Pages
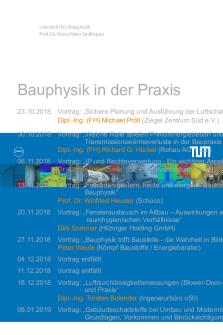
WS1819 BP Praxis Poster
- 1 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu





