Vorlesungsfolien WS1819 PDF

| Title | Vorlesungsfolien WS1819 |
|---|---|
| Author | Si Rr |
| Course | GAC - Grundlagen der Allgemeinen Chemie |
| Institution | Universität Hamburg |
| Pages | 21 |
| File Size | 1.6 MB |
| File Type | |
| Total Downloads | 21 |
| Total Views | 143 |
Summary
Download Vorlesungsfolien WS1819 PDF
Description
Allgemeine Chemie mit Übungen Felix Brieler (Raum AC 317a, Tel. 4308)
Wintersemester 2018/2019
Das Modul CHE 001 CHE 001 A 62-001.2
Experimentalvorlesung: Grundlagen der Chemie (Prof. Fröba) inkl. Sicherheitsunterweisung
62-001.3
Allgemeine Chemie mit Übungen
62-001.7 (62-001.8
Experimentalvorlesung: Grundlagen der Chemie – Ergänzung für Nanowissenschaftler Experimentalvorlesung: Grundlagen der Chemie II im Sommersemester)
CHE 001 B 62-001.5
Grundpraktikum in Allgemeiner Chemie mit Begleitseminar
Prüfungen: Klausur am Ende des Semesters 2
1
Inhalt der Vorlesung
1. Maßeinheiten und Konzentration 2. Reaktionsgleichungen und Stöchiometrie 3. Bindungsarten, LEWIS-Formeln und VSEPR-Modell 4. Oxidationszahlen und Redoxreaktionen 5. Das chemische Gleichgewicht und seine Beeinflussung 6. Löslichkeit und Löslichkeitsprodukt 7. Säuren, Basen, Puffer und Indikatoren 8. (Elektrochemie, NERNSTsche Gleichung) 9. Abschlussübungen 3
Lehrbücher
ca. 65 Euro (broschiert)
ca. 80 Euro (broschiert) 4
2
Lehrbücher
ca. 60 Euro (gebunden)
ca. 30 Euro (broschiert) 5
Lehrbücher
ca. 40 Euro (broschiert)
ca. 100 Euro (gebunden) 6
3
Lehrbücher
je ca. 80 Euro (gebunden) 7
Lehrbücher
Als ebook verfügbar: Mortimer "Chemie" (Thieme Verlag) Riedel/Janiak "Anorganische Chemie" (de Gruyter Verlag) Hollemann/Wiberg "Lehrbuch der Anorganischen Chemie (de Gruyter Verlag) Jander/Jahr "Maßanalyse" (de Gruyter Verlag) "Fit in Anorganik" (Springer Verlag)
8
4
SI-Maßeinheiten Système International d'unités Zu messende Größe
Einheit
Symbol
Länge
Meter
m
Masse
Kilogramm
kg
Sekunde
s
Temperatur
Kelvin
K
Stoffmenge
Mol
mol
Elektrischer Strom
Ampère
A
Leuchtstärke
Candela
cd
Basiseinheiten
Zeit
9
SI-Maßeinheiten Système International d'unités Zu messende Größe
Einheit
Symbol
Quadratmeter
m2
Kubikmeter
m3
Liter (1 L = 1 dm3)
L
Gramm pro Kubikzentimeter
g/cm3
Mol pro Liter
mol/L
Energie
Joule (= kg m2 s-2)
J
Druck
Pascal (= kg m-1 s-2)
Pa
Abgeleitete Einheiten Fläche Volumen Dichte Stoffmengenkonzentration
Bar
(105
Pa = 1 bar)
bar 10
5
Präfixe bei Vielfachen der Maßeinheiten
Präfix Präfix
Abkürzung
Faktor
Abkürzung
Faktor
deci-
d
10-1
giga-
G
109
centi-
c
10-2
mega-
M
106
milli-
m
10-3
kilo-
k
103
micro-
µ
10-6
hecto-
h
102
nano-
n
10-9
deca-
da
101
pico-
p
10-12
femto-
f
10-15
11
Herstellen von Lösungen aus Feststoffen
1. Abwiegen des Feststoffes auf Wägepapier oder in einem Becherglas
2. Feststoff in 50-80% des Endvolumens auf einem Magnetrührer lösen
3. Lösung in einem Messzylinder auf das Endvolumen auffüllen 12
6
Aufgaben zu Kapitel 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 L einer 500 mM NaCl-Lösung herstellen 200 mL einer 50 mM NaOH-Lösung herstellen 400 mL 20%ige Glucoselösung herstellen In 500 mL Wasser werden 15 g NaCl gelöst. Welche Molarität hat die Lösung? 500 mL 0.5 M NaOH aus 3 M NaOH herstellen Verdünnung von 10 mL 1.2 M NaCl auf 0.7 M NaCl Zu 50 mL einer 0.9 M NaCl-Lösung wurden versehentlich 20 statt 10 mL Wasser hinzugegeben. 8. 500 mL 3 M Essigsäure aus 100%iger Essigsäure herstellen 9. 200 mL 5 M NaOH aus 32%iger NaOH herstellen 10. Aus 5 molarer NaCl-Lösung sollen 800 mL 20%iger NaCl-Lösung hergestellt werden. Wie viel 5 M NaCl muss man einsetzen?
13
Wiederholung Kapitel 1
Atomgewicht (Einheit u) Avogadro-Zahl NA = 6.022 · 1023 Elementareinheiten = 1 Mol molare Masse (Einheit g/mol). Stoffmengen-Konzentration c (Einheit mol/L) SI-Maßeinheiten Lösungen herstellen (molare, prozentige, …)
14
7
Molekülstruktur Molekülgestalt wird durch alle Elektronenpaare bestimmt, bindende und freie Elektronenpaare (schwarze "Stäbe") an einem Zentralatom (rot): 2
3
4
5
6
7
© Wile VCH, Weinheim; Atkins / Chemie einfach all es; ISBN:
52 3157 9
jeweils maximaler Abstand der Elektronenpaare durch Abstoßung Abstoßung zwischen bindenden und freien Elektronenpaaren nicht gleich groß! Vorhersage der Molekülgestalt möglich: VSEPR-Modell 15
Molekülstruktur Molekülgestalt einfacher Moleküle (ein Zentralatom, bis zu sieben terminale Atome)
schwarze "Stäbe": bindende Elektronenpaare
© Wile VCH, Weinheim; Atkins / Chemie einfach alles; ISBN:
52 3157 9
freie Elektronenpaare am Zentralatom sind nicht gezeigt 16
8
Aufgaben zu Kapitel 3
1. Zeichnen Sie die Valenzstrichformeln für folgende Moleküle und Molekülionen einschließlich der freien Elektronenpaare und Formalladungen: GeH4, SeF3+, SCl2, PCl4+, PCl6-, AsF4-, XeF5+, H4SiO4, H3PO4, H2SO4 2. Welche Verbindungen gehorchen nicht der Oktettregel? 3. Geben Sie den räumlichen Bau der gezeichneten Moleküle sowie die Form des Koordinationspolyeders (inklusive der freien Elektronenpaare) an!
17
Wiederholung Kapitel 2 und 3
Reaktionsgleichungen und Energieumsatz ionische Bindungen, Kation und Anion Elektronegativität
O=C=O - + |C ≡ O|
kovalente Bindungen Oktettregel, Formalladung Molekülgestalt, VSEPR-Modell
18
9
Regeln für das Ermitteln von Oxidationszahlen 1. Atome in Elementen haben die Oxidationszahl 0. 2. Bei einatomigen Ionen ist die Oxidationszahl gleich der Ladung. 3. Die Summe der Oxidationszahlen entspricht der Gesamtladung des Moleküls. 4. Fluor hat in allen Verbindungen die Oxidationszahl –I. 5. Metalle haben positive Oxidationszahlen. 5. Alkalimetalle +I 5. Erdalkalimetalle +II 5. Aluminium +III 6. Wasserstoff hat gegenüber Nichtmetallen die Oxidationszahl +I, gegenüber Metallen (und Bor) die Oxidationszahl –I. 7. Sauerstoff hat die Oxidationszahl –II, in Peroxiden (H2O2) –I. 19
Aufgaben zu Kapitel 4 1. Bestimmen Sie jeweils die Oxidationszahl des Zentralatoms der folgenden Moleküle und Molekülionen: SO32– , NO2 –, SeF3+, PCl4+, PCl6– , AsF4–, XeF5+, UO22+ , AsH3 2. Geben Sie Beispiele für Verbindungen des Stickstoffs in den Oxidationsstufen +V bis –III. 3. Vervollständigen Sie die folgenden Redoxgleichungen: a) Experimentell wurde festgestellt, dass Permanganat-Ionen in saurer Lösung aus Chloriden Chlorgas entstehen lassen und selber als Mn2+ in Lösung verbleiben. b) Chlorgas wird in heiße Lauge eingeleitet. Es entstehen Chlorid und Chlorat. c) Cu + HNO3 ⇌ Cu2+ + NO d) Cr2O72– + H2S ⇌ Cr3+ + S e) SbH3 ⇌ Sb(OH)4– + H2 f) P4 ⇌ H2PO2– + PH3
20
10
Wiederholung Kapitel 4
Oxidation und Reduktion immer gekoppelt Elektronenübertragungsreaktion Reduktionsmittel / Oxidationsmittel Oxidationszahlen Symproportionierung / Disproportionierung Aufstellen von Redoxgleichungen
21
Das chemische Gleichgewicht
22
11
Das chemische Gleichgewicht Beispiel: H2 (g) + I2 (g) ⇌ 2 HI (g) Reaktion ist hier nicht zu Ende! Hin- und Rückreaktion finden nach wie vor statt, aber mit exakt gleicher Geschwindigkeit. Ein chemisches Gleichgewicht ist also kein statischer Zustand, sondern ein dynamisches System.
23
Aufgaben zu Kapitel 5 1.
2 Ag2O (s) ⇌ 4 Ag (s) + O2 (g)
DH = 62 kJ/mol
Wie wird die Gleichgewichtslage verändert, wenn a) Silber zugesetzt wird b) der Druck erhöht wird c) die Temperatur erhöht wird d) Platin als Katalysator eingesetzt wird?
2. Für die Reaktion NiO (s) + CO (g) ⇌ Ni (s) + CO2 (g) ist Kc = 4540 bei 936 K und 1580 bei 1125 K. Ist die Reaktion exo- oder endotherm? Wird das Gleichgewicht vom Druck beeinflusst? 24
12
Aufgaben zu Kapitel 5 3. Berechnen Sie Kc für das Gleichgewicht H2 (g) + I2 (g) ⇌ 2 HI (g) aus den Gleichgewichtskonzentrationen c(H2) = 0.0064 mol/L, c(I2) = 0.0016 mol/L, c(HI) = 0.0250 mol/L bei 395 °C. 4. Beim Erhitzen von HgO auf 450 °C in einem evakuierten Gefäß stellt sich das Gleichgewicht 2 HgO (s) ⇌ 2 Hg (g) + O2 (g) mit einem Gesamtdruck von 1.084 bar ein. Wie groß ist Kp bei 450 °C?
25
Aufgaben zu Kapitel 5
5. Für das Gleichgewicht H2O (g) + CO (g) ⇌ H2 (g) + CO2 (g)
DH = –41 kJ/mol
ist Kc = 1.30 bei 750 °C. Wenn 0.600 mol H2O (g) und 0.600 mol CO (g) bei 750 °C in einem Einliter-Gefäß gemischt werden, welche Konzentrationen stellen sich dann für die vier Substanzen ein? Ist das Gleichgewicht druck- und temperaturabhängig?
26
13
Wiederholung Kapitel 5
chemische Reaktionen sind reversibel Gleichgewicht: Hin- und Rückreaktion gleich schnell dynamischer Zustand Massenwirkungsgesetz homogene und heterogene Gleichgewichte Prinzip von LE CHATELIER
27
Aufgaben zu Kapitel 6 1. Bei 25 °C lösen sich 7.8 · 10–5 mol Ag2CrO4 in einem Liter Wasser. Wie groß ist das Löslichkeitsprodukt? 2. Bei 25 °C lösen sich 0.00188 g AgCl in einem Liter Wasser. Wie groß ist das Löslichkeitsprodukt? 3. Wird Mg(OH)2 ausgefällt, wenn in einer Lösung von Magnesiumnitrat, c = 0.0010 mol/L, die Konzentration der Hydroxid-Ionen auf c = 10-5 mol/L eingestellt wird? KL (Mg(OH)2) = 8.9 · 10–12 mol3/L3 4. Wie groß ist die Löslichkeit von CaSO 4 (Gips) in a) reinem Wasser b) 0.1 molarer Schwefelsäurelösung c) 0.1 molarer NaCl-Lösung?
KL (CaSO4) = 2.4 · 10–5 mol2/L2 28
14
Aufgaben zu Kapitel 6
5. Wie viel Kubikmeter Wasser werden benötigt, um ein Mol Mg(NH4)PO4 zu lösen? KL (Mg(NH4)PO4) = 10–12 mol3/L3 6. Sowohl Ba2+ als auch Ag+-Ionen bilden ein schwerlösliches Carbonat. Für das Bariumsalz beträgt das Löslichkeitsprodukt 1.6 · 10–9 mol2/L2, Silbercarbonat hat ein Löslichkeitsprodukt von 8.2 · 10–12 mol3/L3. a) Welches der beiden Salze hat die niedrigere Löslichkeit? b) Wie lässt sich ausgefälltes BaCO3 wieder in Lösung bringen (Reaktionsgleichung)?
29
Wiederholung Kapitel 6
gesättigte Lösungen Löslichkeitsprodukt KL (Spezialfall des Massenwirkungsgesetzes) Löslichkeit L gleichioniger Zusatz
30
15
Aufgaben zu Kapitel 7 1. Bezeichnen Sie jeweils die zusammen gehörigen Säure/Base-Paare! NH3 + HCl ⇌ NH4+ + Cl– HCN + SO 42–
HSO4– + CN–
H2O + NH2– ⇌ NH3 + OH– 2 HCO3– ⇌ CO2 + H2O + CO32– 2. Wie groß sind c (H3O+) und c ( OH–) in einer wässrigen Lösung, wenn: a) pH = 1.23, b) pH = 10.92, c) pOH = 4.32 31
KS-Werte einiger Säuren Säure HClO4
Perchlorsäure
korr. Base
KS
ClO4
10 9
sehr starke Säure
10 6
starke Säure
10 3
starke Säure
10 –2
mittelstarke Säure
10 –2
mittelstarke Säure
–
–
HCl
Salzsäure
Cl
H2SO4
Schwefelsäure
HSO 4
HSO4–
Hydrogensulfat -Anion
SO42–
H3PO4
Phosphorsäure
H2PO4
CH3COOH
Essigsäure
CH3COO–
10 –5
schwache Säure
H 2S
Schwefelwasserstoff
HS–
10 –7
schwache Säure
NH4+
Ammonium-Kation
NH3
10 –9
sehr schwache Säure
Cyanwasserstoff
CN–
10 –9
sehr schwache Säure
HCN
–
–
Je schwächer eine Säure ist, desto stärker ist ihre konjugierte Base. Aber nicht immer korrespondiert eine schwache Säure mit einer starken Base! 32
16
pH-Werte einiger Säuren
aus: Brown / LeMay / Bursten, Chemie – Die zentrale Wissenschaft, 10. Auflage, Pearson Verlag, ISBN: 3-8273-7191-0 33
Aufgaben zu Kapitel 7
3. Aus 3.0 · 10–3 mol einer schwachen Säure HX und 6.0 · 10–4 mol NaX wurde eine Lösung mit pH = 4.80 hergestellt. Wie groß ist KS von HX? 4. Für Milchsäure ist KS = 1.5 · 10–4 mol/L. Wie groß ist c (H3O+), wenn 0.15 mol/L Milchsäure in Lösung sind? Wie viel Prozent der Milchsäure sind dissoziiert?
5. In einer wässrigen Lösung von Ammoniak ist c (OH–) = 1.8 · 10–3 mol/L. Wie groß ist die NH3-Konzentration? KS (NH4+) = 10–9.21 mol/L
34
17
Titrationskurven
aus: Brown / LeMay / Bursten, Chemie – Die zentrale Wissenschaft, 10. Auflage, Pearson Verlag, ISBN: 3-8273-7191-0 35
Titrationskurven
aus: Brown / LeMay / Bursten, Chemie – Die zentrale Wissenschaft, 10. Auflage, Pearson Verlag, ISBN: 3-8273-7191-0 36
18
Säure/Base-Indikatoren
37
Aufgaben zu Kapitel 7 6. Wie groß ist der pH-Wert in einer 0.1 molaren NH4Cl-Lösung?
KS (NH4+) = 10–9.21 mol/L
7. Wie groß ist der pH-Wert in einer 0.1 molaren Natriumacetat-Lösung? KB (CH3COO–) = 10–9.2 mol/L
8. Wie groß ist der pH-Wert einer 0.1 molaren Ammoniumacetat-Lösung?
9. Wie groß ist der pH-Wert einer 0.1 molaren Lösung aus Natriumhydrogencarbonat? KS (H2CO3) = 10–6.52 mol/L KS (HCO3–) = 10–10.40 mol/L 38
19
Wiederholung Kapitel 7 Säure: bildet in Wasser H3O+ ("Oxonium"-Ion), ist Protonendonator Base: bildet OH– ("Hydroxid"-Ion), ist Protonenakzeptor pH = –log c (H3O+) "korrespondierende" Säure/Base-Paare Säurekonstante KS =
c (H3O+) · c (A–) c (HA)
starke und schwache Säuren und Basen, Titrationskurven
pH
Puffersysteme (schwache Säure mit korrespondierender Base)
39
Messung von Redoxpotentialen Standardwasserstoffelektrode
aus: Brown / LeMay / Bursten, Chemie – Die zentrale Wissenschaft, 10. Auflage, Pearson Verlag, ISBN: 3-8273-7191-0 40
20
Messung von Redoxpotentialen galvanische Zelle mit Normalwasserstoffelektrode
aus: Brown / LeMay / Bursten, Chemie – Die zentrale Wissenschaft, 10. Auflage, Pearson Verlag, ISBN: 3-8273-7191-0 41
Normalpotentiale elektrochemische Spannungsreihe
aus: Brown / LeMay / Bursten, Chemie – Die zentrale Wissenschaft, 10. Auflage, Pearson Verlag, ISBN: 3-8273-7191-0 42
21...
Similar Free PDFs

Vorlesungsfolien WS1819
- 21 Pages

Zusammenfassung TM3 WS1819
- 5 Pages
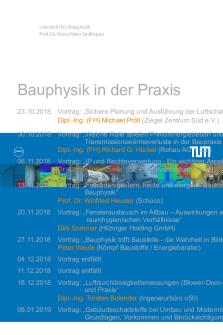
WS1819 BP Praxis Poster
- 1 Pages

CoMa I - Vorlesungsfolien - TU Berlin
- 205 Pages

HA01 WS1819 Losungen
- 4 Pages

BWL Zusammenfassung WS1819
- 23 Pages

Stundenplan ws1819 sem1
- 1 Pages

MKEP4 Exercise 05 WS1819
- 2 Pages

C-Skript WS1819 - Karow_skripte
- 92 Pages

Praktikum 01 WS1819
- 3 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu





