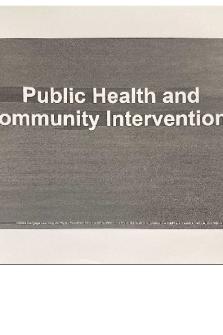Public Health II - Zusammenfassung PDF

| Title | Public Health II - Zusammenfassung |
|---|---|
| Author | Jenny Fiedler |
| Course | Public Health II |
| Institution | Universität Bayreuth |
| Pages | 24 |
| File Size | 916.3 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 40 |
| Total Views | 130 |
Summary
Public Health II - Zusammenfassung...
Description
Dozenten: Schorling/Klug
Universität Bayreuth
WS 17/18
Public Health II - Zusammenfassung VL -
1.
EINFÜHRUNG
APUBLIC HEALTH DEFINITION: Public Health ist eine von der Gesellschaft organisierte, gemeinsame Anstrengung mit dem Ziel der (1) Erhaltung und Förderung der Gesundheit der gesamten Bevölkerung oder von Teilen der Bevölkerung (2) Vermeidung von Invalidität (3) Versorgung der Bevölkerung mit präventiven, kurativen und rehabilitativen Diensten SYNONYM: öffentliche Gesundheitspflege
HANDLUNGSFELDER:
▪
Wissenschaftliche Forschung an (universitären) Instituten
▪
Praxis in den Public-Health-Institutionen (RKI)
Aufgabe: Schutz und Überwachung der Gesundheit der Bevölkerung (=Surveillance) Erarbeitung und Durchführung von Impf- und Screening-Programmen sowie Aufklärungskampagnen
▪
Gesundheits- und Sozialpolitik Aufgabe: Steuerung des GW durch Verordnungen und Gesetze Schaffung gesundheitsfördernder Lebens- und Arbeitsbedingungen
ENTWICKLUNGEN UND HERAUSFORDERUNGEN:
▪
Demografische Entwicklungen in Industrienationen
▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Anstieg chronisch-degenerativer Erkrankungen Zunahme des Bevölkerungsanteils mit Übergewicht Soziale Ungleichheit in Gesundheitszustand und Versorgung Dominante Rolle der kurativen Medizin (statt präventiver) Fragmentierte Gesundheitssysteme
Dozenten: Schorling/Klug
B (1) (2) (3) (4)
Universität Bayreuth
WS 17/18
GESUNDHEIT UND KRANKHEIT
Betrachtungsweise abhängig von der Perspektive Existenz zahlreicher Zwischenstufen von Gesundheit/Krankheit Vorstellungen, wie Gesundheit/Krankheit entstehen, unterscheiden sich stark Betrachtung von Krankheit/Gesundheit auf verschiedenen Ebenen möglich
Individuum: Sicht der (Individual)Medizin Bevölkerung: Sicht der Public Health
GESUNDHEITLICHE UNGLEICHHEIT: Unterschiede der Bevölkerungsgruppen hinsichtlich: Soziale Schicht Ethnie Religion Nationalität Alter Geschlecht
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
GESELLSCHAFT UND GESUNDHEIT: Unterschiede innerhalb der Gesellschaft hinsichtlich:
▪ ▪
Einkommen
Berufliche Position Bildung
▪
▪
Sozialprestige
durch: (1) Krankheitserreger (2) Verhaltensweisen (3) ungleiche Ressourcenverteilung
Unterschiede in gesundheitlichen Chancen von Bevölkerungsgruppen ▪ Ungleichheit: häufig freiwillig, daher nicht zu ändern ▪ Ungerechtigkeit: vermeidbar und gravierender
▪ GESCHLECHT UND GESUNDHEIT: SEX = biologische Unterschiede
▪
Risiko bestimmter Krankheiten
▪
Ausprägung von Symptomen
Lebenserwartung
GENDER = psychologische, soziale und kulturelle Dimension
▪ ▪ ▪
Soziale Rollen Verhaltensweisen und Beziehungen Wertschätzung
Dozenten: Schorling/Klug
C
Universität Bayreuth
WS 17/18
PRÄVENTION UND GESUNDHEITSFÖRDERUNG
DEFINITION: Prävention (lat. praevenire) bedeutet, einer Krankheit zuvorkommen ANSATZPUNKTE: (1) Gesundheit über Krankheit bis hin zum Tod
Primär-, Sekundär-, und Tertiärprävention
(2) Bevölkerungsebene oder Risikogruppen
Bevölkerungs- bzw. Hochrisikostrategie
(3) Individuum oder dessen Umwelt
Verhaltens- bzw. Verhältnisprävention
ZIEL: Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung, Bevölkerungsgruppen oder einzelner Personen
(1) Gesundheit über Krankheit bis hin zum Tod
PRIMÄRPRÄVENTION Vermeidung von: ▪
Gesundheitsschäden
▪
Neuerkrankungen Todesfällen
▪
Wahrscheinlichkeit
(2) Prävention auf Bevölkerungsebene und Risikogruppen
HOCHRISIKOSTRATEGIE IDEE: Menschen sind entweder gesund oder krank ZIEL: Identifikation von Personen mit erhöhtem Risiko
Reduktion durch geeignete Maßnahmen
Veranschaulichung vgl. 1 F34
VORTEILE:
▪ ▪ ▪
Intervention wird Individuum gerecht Hohe Motivation von Betroffenen Politisch einfache Umsetzung
NACHTEILE:
▪ ▪ ▪
„Labeling“ der Betroffenen Nutzen für Bevölkerung gering Reine Symptombekämpfung
nur Minderheiten mit deutlichem Risiko profitieren, Mortalität kaum beeinflusst
Dozenten: Schorling/Klug
Universität Bayreuth
WS 17/18
VORTEILE:
HOCHRISIKOSTRATEGIE
▪
Potentiell großer Nutzen für Bevölkerung und Hochrisikogruppe
IDEE: Berücksichtigt Verteilung des Risikos in der gesamten Bevölkerung ZIEL: Verschiebung der Risikoverteilung zu günstigeren Werten
▪
Ursachenbekämpfung
NACHTEILE:
▪
Nutzen für Individuum wenig sichtbar
▪
Konfliktpotenziell mit kulturellen Normen oder wirtschaftlichen Interessen
Veranschaulichung vgl. 1 F36
▪
Politisch schwierige Umsetzung
(3) Individuum und dessen Umwelt VERHALTENSPRÄVENTION
Strategien, die gesundheitsrelevante Verhaltensweisen direkt beeinflussen
Initiieren gesundheitsfördernder und Vermeidung -riskanter Verhaltensweisen
Annahme: Individuelles Handeln und Verhalten trägt zur Entstehung von Krankheiten bei Ziel:
Erkrankungswahrscheinlichkeit
INSTRUMENTE Gesundheitserziehung Gesundheitsaufklärung Gesundheitsberatung
▪ ▪ ▪
Massenmedien
Eigene Programme Einsicht
WICHTIGSTE ZIELE:
Tabakkonsums Gesunde Ernährung
Stressverarbeitung Körperliche Bewegung
Dozenten: Schorling/Klug
Universität Bayreuth
WS 17/18
VERHÄLTNISPRÄVENTION
Strategien, die gesundheitsrelevante Umgebung des Individuums beeinflussen
Setzt an sozialen Determinanten der Gesundheit an
▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Ressourcen soziale Unterstützung Stressbelastung Arbeitsbedingungen Zugang zu medizinischer Versorgung
Meist Primärprävention
Instrumente: normativ-regulatorische Maßnahmen!
▪ ▪ ▪ ▪ ▪
D
Veränderung der Arbeitsbedingungen in Betrieben Kommunale Aktivitäten zur Verbesserung öffentl. Hygiene Flouridierung des Trinkwassers Rauchverbot in öffentl. Gebäuden Anschnallpflicht
PUBLIC HEALTH RELEVANZ
a) Bedarfsanalyse: hohe Prävalenz, hohe Morbidität/Mortalität, hohe Kosten, Möglichkeit der Prävention besteht b) Entwicklung v. Maßnahmen: Primär- bis Tertiärprävention, Verhaltens- oder Verhältnis-Prävention, Partizipation, Evidenzbasierung c) Evaluation: Effizienz/Effektivität, Nachhaltigkeit/Stetigkeit, Übertragbarkeit, ggf. Optimierung
Dozenten: Schorling/Klug
2.
Universität Bayreuth
EINFÜHRUNG IN DIE PSYCHIATRIE
AALLGEMEINES
KLASSIFIKATION: DSM-V
ICD-10 Kapitel V (F)
Klinisch-diagnostische Leitlinien American Psychatric Association
RISIKOFAKTOREN: PSYCHOSOZIALE Ungünstige Bindungserfahrung Trennungserfahrung Psychische Störung früherer Generationen
▪ ▪ ▪
▪
Mangeln de Leistungsfähigkeit
B
DEPRESSION
DEFINITION: Depression ist eine krankhafte Störung der Affektivität eines Menschen bzw. dessen Gemütszustandes
WS 17/18
Dozenten: Schorling/Klug
▪ ▪ ▪ ▪
Universität Bayreuth
WS 17/18
mit einer sichtbaren, beschreibbaren Symptomatik (Psychopathologie) mit innerseelischen und/oder äußeren prädepressiven Ereignissen und Belastungen überwiegend von Verlust-/Überforderungs-/Kränkungscharakter (Psychodynamik) mit einer depressiven Persönlichkeitsstruktur
▪
mit beschreibbaren depressiven Verhaltensweisen des Appels, des Rückzuges, der Dysphorie und des Negativismus
▪
mit einer depressiven Einstellung der Hoffnungs- und Hilflosigkeit, Ich-Insuffizienz, Selbstentwertung und Schuldzuweisung an sich selbst
hinzu kommt das Auftreten des somatischen Syndroms
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Interessenverlust und Anhedonie Mangelnde Reaktivität auf positive Ereignisse/Umgebung frühes Erwachen (>2Std vor üblicher Zeit) Morgentief in Stimmung und Antrieb beobachtbare, psychomotorische Hemmung oder Agitiertheit deutlicher Appetitverlust Gewichtsverlust (>5% des Körpergewichts) im letzten Monat deutlicher Libidoverlust Leibesgefühlsstörungen („mental pain“)
GEFORDERTE DIAGNOSEKRITERIEN: Hauptsymptome (2-3, Dauer je 2 Wochen) (1) gedrückte Stimmung (2) Interessenverlust, Freudlosigkeit (3) Antriebsminderung Andere Symptome (2-4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen Schuldgefühle, Gefühl von Wertlosigkeit Negative und pessimistische Zukunftsperspektive Suizidgedanken und erfolgte Selbstverletzung und Suizidhandlungen Schlafstörungen Appetitlosigkeit
sowie Auftreten des somatischen Syndroms
PERSÖNLICHKEITSSTRUKTUR
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
übermäßige Leistungsorientiertheit Selbstwertgefühl abhängig von Leistung Sehr hohes Ideal-Ich-Bild Beziehungsanpassung und - abhängigkeit rasch und anhaltend verletz- und kränkbar stark schuldbezogen durch überstrenges Gewissen/Über-Ich
Dozenten: Schorling/Klug
Universität Bayreuth
BEDEUTUNG:
Häufigste psychische Erkrankung Rate der Erkennung und Behandlung zu gering Suizidrisiko hoch Häufige Ursache für Arbeitsunfähigkeit Anhaltende Erkrankung möglich, Behinderung der Teilhabe am Leben
DD:Dysthymie
C
VERSORGUNGSBEDARF VS. VERSORGUNGSREALITÄT
BUNDESGESUNDHEITSSURVEY 2000 120 100 80 60 40 20 0 SUBSTANZSTÖRUNGEN
URSACHEN FÜR VERSORGUNGSDEFIZIT (1) (2) (3) (4)
Ausbleiben von Intervention trotz ersuchter Hilfe Nicht-Erkennen der Diagnose, Fehldiagnose Ablehnung fachspezifischer Dienste mangelnde Versorgungsdichte und Wartezeiten
D
von Diagnose bis zur 1. Intervention vergehen durchschnittlich 7,4 Jahre
ÖKONOMISCHE AUSWIRKUNGEN
Direkte Kosten:
28,7 Milliarden € jährlich (2015)
Indirekte Kosten:
14,1% aller AU-Tage, 43% der Frühverrentungen 34 Tage durchschnittliche Krankschreibungsdauer pro Fall
WS 17/18
Dozenten: Schorling/Klug
Universität Bayreuth
WS 17/18
KRANKHEITSBELASTUNG Years lived in Disability (YLD)
Disability adjusted Life years (DAILY)
▪
psychische Erkrankungen bedingen mehr Einschränkungen, sind jedoch nicht tödlicher als andere Krankheiten
▪
die hohe Krankheitslast bedingt sich aus
(1) (2) (3) (4)
hoher Prävalenz häufig frühem Beginn persistierendem Verlauf defizitärer Versorgung
▪
höchste DAILY-Werte für Sucht, MS, Angststörungen und Depression
Kombination aus Häufigkeit und vergleichsweise schwerer Behinderung führt zu enormen
Kosten
KOSTEN-NUTZEN-ANALYSE RoI der ambulanten Psychotherapie - stets positiv!
U = T x ES x SDprod - K
ES =
U: Nutzen T: Anhalten des Effekts in Jahren ES:Effektstärke SD: Standardabweichung der Produktivität (Jahreseinkommen) K: Direkte Behandlungskosten
Behandlungsergebnisse streuen in NV um Mittelwert (Grundlage: z-Wert) ES: Effektstärke der Behandlung M: Mittelwert SD: Streuung
Beispiel: vgl. 3 F40/41
Dozenten: Schorling/Klug
3.
Universität Bayreuth
WS 17/18
HERZ-KREISLAUFERKRANKUNGEN UND ERNÄHRUNGSASSOZIIERTE ERKRANKUNGEN
AHERZKREISLAUFERKRANKUNGEN HYPERTONIE mmHg OPTIMAL NORMAL HOCHNORMAL HYPERTONIE GRAD I HYPERTONIE GRAD II HYPERTONIE GRAD III ISOLIERTE SYST. HYPERTONIE
ARTERIOSKLEROSE DEFINITION: Arterienverkalkung, pathologische Veränderung der Gefäßwände mit Verhärtung, Verdickung und Elastizitätsverlust sowie Lumeneinengung durch Plaque-Entstehung. KLINISCHE FOLGEN Je nach Art der betroffenen Gefäße
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Koronare Herzkrankheit (KHK) Myokardinfarkt Herzinsuffizienz Durchblutungsstörungen (TIA) Zerebrovaskulärer Insult Periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK) Niereninsuffizienz
RISIKOFAKTOREN (1) nicht-beeinflussbare: männliches Geschlecht, Lebensalter (>55/m bzw. >65/w), familiäre Vorbelastung (2) beeinflussbare: Nikotinabusus, Hypertonie, Dyslipidämie, Diabetes Mellitus, Abdominale Adipositas, Bewegungsmangel, Depression, Polyarthritis, psychosoziale Faktoren, Homocysteinämie, CRP > 2mg/dl
PRÄVENTIONS- UND THERAPIEMÖGLICHKEITEN
▪ ▪ ▪
absolute Nikotinkarenz Alkohol < 10g/d/m bzw. < 20g/d/w Kochsalz < 3-5 g/d
Dozenten: Schorling/Klug
▪
Universität Bayreuth
Blutdruck < 140/90 mmHg
▪ ▪
Plasmacholesterin < 190 mg/dl
▪
BMI 20-25 kg/m
B
ERNÄHRUNGSASSOZIIERTE ERKRANKUNGEN
LDL < 115 mg/dl 2
FORMEN
▪ ▪ ▪ ▪
Adipositas Diabetes Mellitus II Karies Metabolisches Syndrom
… URSACHEN
▪ ▪ ▪ ▪ ▪
4.
soziale, technologische und ökonomische Entwicklungen Globalisierung Überangebot/Überproduktion von Lebensmitteln Veränderung des Lebensstils („to-go“) teilweise aggressives Marketing
KREBSERKRANKUNGEN
AALLGEMEINES DEFINITION Krebs bezeichnet eine übermäßige, nicht notwendige und unkontrollierte Zellteilung, die zu Geschwulsten gut- oder bösartiger Natur führen. PRIMÄRPRÄVENTION
Krebsart Lungenkrebs Leberkrebs Darmkrebs Hautkrebs Diverse Krebsarten
SEKUNDÄRPRÄVENTION Screeningprogramme (insb. Darm-, Brust- und Gebärmutterhalskrebs)
WS 17/18
Dozenten: Schorling/Klug
Universität Bayreuth
TERTIÄRPRÄVENTION Kurative therapeutische Behandlung oder palliative Therapie
B SYMPTOME Kardinal:
CASE STUDY – BRUSTKREBS (1) Knotenbildung im Brustgewebe (2) Schwellung der axillären Lymphknoten
frühe Symptome wie Schmerzen oder Sekretabsonderungen selten (10-15%)
DIAGNOSTIK
▪
Inspektion
▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Palpation
▪
Bestrahlung und/oder Chemotherapie
Mammographie Ultraschall Biopsie Ausbreitungsdiagnostik (Szinitgraphie)
THERAPIE
▪ ▪ ▪
Operative Entfernung von Tumor und Metastasen Hormontherapie Molekularbiologische Therapie
5-Jahres-Überlebensquote: ohne axillären Befall 80-85%, mit 5,5 mmol/l bzw. 100mg/dl)
DIAGNOSE Oraler Glucosetoleranztest (oGTT)
Bestimmung des HbA1c („Zuckergedächtnis“ des Hämoglobins)
KOMPLIKATION (Typ II)
C
▪
Mikrovaskulär: Neuro-, Nephro- und Retinopathie
▪
Makrovaskular: ischämischer Infarkt
RISIKOFAKTOREN (Typ II)
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Familiäre Disposition Alter Körpergröße und Fettverteilung Bluthochdruck, Rauchen Übergewicht und Bauchumfang Ethnie Frühe Störung des Blutzuckers
WS 17/18
Dozenten: Schorling/Klug
D
Universität Bayreuth
WS 17/18
SOZIALE AUSWIRKUNGEN
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Sonderbehandlung von Kindern mit DB mell. In Familie, Schule und Freizeit Diskriminierung bei Bewerbung und Erhalt eines Arbeitsplatzes Diskriminierung bei Erhalt oder Verlängerung der Fahrerlaubnis Schlechterstellung von Menschen mit DB mell. bei Abschluss von Versicherungen Sozioökonomische und psychosoziale Belastungen Negatives Image in Medien und Fehlinformation der Öffentlichkeit
KOSTEN Direkte med. Kosten: 5.980 € pro Diabetiker (D: 21 Mrd € pro Jahr) Indirekte med. Kosten: 5.020 € pro Person (D: 7,7 Mrd € pro Jahr)
6.
DEMENZ
AALLGEMEINES DEFINITION Demenz ist ein Syndrom als Folge einer meist chronischen und fortschreitenden Erkrankung des Gehirns mit Störung vieler höherer kortikaler Funktionen, einschließlich Gedächtnis, Denken, Orientierung, Auffassung, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache, Sprechen und Urteilsvermögen im Sinne der Fähigkeit zur Entscheidung. Das Bewusstsein ist nicht getrübt.
Formkreis der neurodegenerativen Erkrankungen (Alzheimer, Huntington, Parkinson und ALS)
in Korrelation mit zunehmendem Lebensalter der Bevölkerung
Dozenten: Schorling/Klug
Universität Bayreuth
WS 17/18
FORMEN
▪
Alzheimer-Demenz
▪ ▪
Vaskuläre Demenz
B
ALZHEIMER ERKRANKUNG
Mischformen
Erstmals beschrieben 1902 von Alois Alzheimer
über Jahre Merkfähigkeitsstörungen bis hin zum Persönlichkeitszerfall
VERLAUF
• Aufnahme neuer Information • komplexes Denken • präzise Ausdrucksweise • Stimmungslabilit ät & Unsicherheit STADIUM I 0 - ca. 7 Jahre
Makroskopische Veränderungen: Hirnatrophie mit Verlust von bis zu 20% Hirnmasse Mikroskopische Veränderungen: Bildung amyloider Plaques, Zerstörung der Mikrotubuli und Störung des Neurotransmittertransfers, Bildung von „Tau-Tangles“
zunehmende Neurodegeneration bei zunehmendem Verlust kognitiver Fähigkeiten
„Demenzschwele“ nach 15-30 Jahren unbemerkter neurobiologischer Veränderung
BEHANDLUNG Medikamentös: Cholinesterasehemmer, Glutamatantagonisten Nicht-Medikamentös: Ergo-, Physio-, Logopädie, Verhaltens-, Musik- und Kunsttherapie
Dozenten: Schorling/Klug
7.
Universität Bayreuth
WS 17/18
INFEKTIONSERKRANKUNGEN
AALLGEMEINE KONZEPTE MERKMALE (1) Kontakt
(2) Ansteckung
(3) Inkubationszeit
(4) Krankheit
(5) Elimination/Trägertum
ÜBERTRAGUNGSWEGE
Schlüsselmerkmal von Infektionserregern
meist horizontale Übertragung = innerhalb von Wirtspopulationen (Ergänzung: vertikale Übertragung = auf nächste Generation)
DIREKT
INDIREKT
Hände (z.B. multiresist. Erreger) Sexualkontakt (STI)
▪ ▪
Tröpfchen (z.B. Pneumokokken) Aerosol (z.B. Masern)
▪ ▪
DEFINITIONEN Epidemie:
Zunahme einer Infektion
über erwartete Basisrate hinaus
zeitliche und örtliche Häufung innerhalb einer Population Bsp.: Influenza Endemie:
Infektion in einer
definierten Population mit stabiler Rate
Bsp.: Malaria in großen Teilen Afrikas
Pandemie:
Zunahme einer Infektion über erwartetet Basisrate hinaus
zeitliche Häufung
...
Similar Free PDFs

Public Health II - Zusammenfassung
- 24 Pages

Final Essay Public Health
- 8 Pages

Introduction to Public Health
- 3 Pages

Public Health - Outline
- 2 Pages

Public Health 101 Notes
- 3 Pages

Public Health Assingm essay
- 13 Pages

Public-Health Midterm Notes
- 40 Pages

Public health assigment
- 16 Pages

Public Health Foundations
- 13 Pages

Public Health Course MAP
- 1 Pages

Public health chapter 5 notes
- 9 Pages

Public health exam 2 notes
- 77 Pages

NSW Public Health Act 2010
- 85 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu