Beispiel Zusammenfassung PDF

| Title | Beispiel Zusammenfassung |
|---|---|
| Author | Anonymous User |
| Course | Zukunftsweisende Führung I |
| Institution | FernUniversität in Hagen |
| Pages | 49 |
| File Size | 1.9 MB |
| File Type | |
| Total Downloads | 59 |
| Total Views | 140 |
Summary
Zusammenfassung Zukunftsweisende Führung ...
Description
Zukunftsweisende Führung Begrifflichkeiten Emergenz: Entstehen neuer Strukturen, Eigenschaften, Prozesse in einem komplexen Systeme. Das entstandene Ganze oder Neue ist mehr als die Summe seiner Teile. Habitus: Handlungs-, Denk- und Wahrnehmungsmuster Reduktionisimus: Phänomene auf seine Elemente oder die kleinsten Bestandteile, zurückzuführen (“zu reduzieren”), nicht vereinbar mit der Vorstellung Emergenz Stimmungen: klaren Fokus oder ein klares Objekt. Im Gegensatz zu Emotionen bringen die ein klares Gefühl mit sich, während Stimmungen eher diffuse oder unbestimmte Gefühle hervorrufen. Sprachspiel: sprachliche Äußerung, innerhalb einer kontextuell eingebetteten Verwendungssituation Variable: Ausschnitte der Beobachtungsrealität in Form eines konditionalen “Wenn-Dann”Satzes. Unabhängige gehört zum “Wenn-Teil” und abhängige Variable zum “Dann”-Teil einer Hypothese in der sich unabhängige Variablen (Ursachen, Bedingungen) widerspiegeln. Varianz: Streuungsmaß, welches die Verteilung von Werten um den Mittelwert kennzeichnet.
Führung heute Navigation durch die Führungslandschaft Hauptströmungen: - Eigenschaftstheorieren: persönliche Eigenschaften sagen erfolgreicher Führung vorher - Führungsverhaltensforschung: Führungsstile sowie individuelles Verhalten von Führungskräften (Dichotomie zwischen MA-Orientierung und Sachorientierung) - Kontingenzmodell: Berücksichtigung des Kontextes - Dyadentheorie: Leader-Menber Exchange (LMX) - Visonäre Führung: “meaning-making”, Werteorientierung fördern, transformationales Führungsverhalten steigert die Motivation oder charismatische Führung
Kritische Stimmen - Ruf nach Alternativen -
Fokus auf Führungsindividuum überwinden
1
-
-
individueller Einfluss über die gesamte Organisation und zur Entwicklung sozialer Ordnung führt berücksichtigt Individuen, Prozesse, Kontexte gleichermaßen Führung als Prozess emergente Prozesse der Entwicklung von Führerschaft zu erfassen Feldstudien und Beobachtungen seien gut geeignet, um informelle Führung und dynamische Aspekte der Führungsentwicklung zu erfassen Neigung zu heroischen Verzerrung sowie Romantisierung von Führung ist eng verknüpft mit unserer westlichen Kultur und Tradition In den Medien personenbezogene Fokussierung auf die Errungenschaften einzelner Führungspersönlichkeiten an der Spitze Methodologische und methodische Einseitigkeiten behindern eine umfassende Erfassung von Führungsphänomenen Organisationale Entwicklungen: Dezentralisierung, Auflösung der Organisationsgrenzen, zunehmende Netzwerkeinbettung, projektartige Konstellationen weniger Bereitschaft, traditionell positionsgebundene oder hierarchische Führung anzuerkennen Notwendigkeit von pluraler Führung Aufmerksamkeitsverschiebung (Macht mit Anderen von der objektiv positivistischen Perspektive zur subjektiv orientierten interpretativen bzw. sozial konstruktionistische Perspektive
2
Paradigmatischer Hintergrund und Methodologie Paradigmen -
-
Paradigma: Beispiel, Vorbild, Muster allgemeiner Begriff für die implizite oder explizite Weltsicht oder die zentralen Annahmen sowie theoretischen Leitsätze ´, die von einer Wissenschaftsgemeinde geteilt werden einfache Modelle der Realität (z.B. Atommodell)
Relevante Paradigmen mit zugehörigen Metaphern -
funktionalistische Paradigma (Kernannahmen des Funktionalismus, Organisation als Maschine, Managementmodelle sind bsp. Arbeitsteilung, Linienorganisation, Zentralisierung, objektive Erfassung) - interpretative Paradigma (Wirklichkeit existiert nicht als objektives Abbild, soziale Realität entsteht durch Interaktion von Individuen interpretiert) - radikal humanistische Paradigma (psychisches Gefängnis, pathologischen sowie das Individuum eingrenzenden und in seiner Entwicklung hemmenden äußeren Faktoren in der Analyse → kritische Analyse der Umstände, die beim Menschen eine Entfremdung von seiner Natur und seinen Bedürfnissen hervorrufen, ideologische Herrschaft) - radikal strukturalistische Paradigma (Unterdrückung und Beherrschung in organisationalen und gesellschaftlichen Strukturen, gesellschaftliche Machtstrukturen) → Dualismus als Basiskategorisierung: Unterscheidungsdimensionen subjektiv und objektiv
3
Ordnungsdimension -
Wissenschaft wird mit Objektivität gleichgesetzt Subjektiv-Objektiv Kontinuums Forschungstraditionen zwischen den Polen Grundpositionen zwischen Ontologie und Epistemologie Positivismus mit Objektivität verknüpft
Ontologie Zentrale ontologische Fragen: Was existiert? Was kann erforscht werden? Wer sind wir? Gibt es eine Welt dort draußen, die unabhängig von unserem Wissen existiert? Epistemologie Lehre vom Wissenserwerb (Erkenntnistheorie). Zentrale epistemologische Fragen: Was können wir wissen? Wie können wir Wissen/ Erkenntnis erlangen? Woher kommt die Erkenntnis (z.B. aus Erfahrung oder vom Verstand)?
Konstuktivismus und sozialer Konstruktionsimus
Annahmen über die Realität (ontologische Grundposition)
Positivistische/ postpositivistische Tradition: Konstuktivismus
Interpretative Tradition: Sozialer Konstruktionismus
Die Welt (Realität) existiert unabhängig von unserem Wissen (im Sinne von objektiv vorhanden)
Es gibt eine Welt (Realität) außerhalb des Subjekts, aber die soziale Wirklichkeit existiert nicht unabhängig vom Individuum; Gesellschaftliche und soziale Wirklichkeit
4
werden sozial konstruiert und interpretativ erschlossen, d.h. intersubjektiv in Diskursen und Interaktionen Annahmen über Erkenntnis und Wissen (epistemologische Grundposition)
Individuen entwickeln exakte Bilder und Verständnisse von der Welt (Realität); auf dieser Basis sind Forschende in der Lage, objektive Gesetze menschlichen Handelns zu identifizieren; objektive Wirklichkeit kann im Spiegel der Wissenschaft verstanden werden (Realismus)
Wirklichkeit und Wissen sind gesellschaftlich, kulturell, historisch und diskursiv beeinflusst; Wissen/ Erkenntnis sind weder objektiv noch rein subjektiv (relativistische Zwischenposition zwischen Objektivität und Subjektivität); Erkenntnisgewinnung erfolgt über eine Interpretation und das Verstehen von sozial konstruierter Wirklichkeit
Forschungsfokus
Entitäten, wie etwa Individuen und ihre Eigenschaften, Identitäten, Rollen, individuelle Strategien, Verhaltensstile, Skills, Strukturen
Intersubjektive soziale Wirklichkeit, und wie sie geschaffen wird (z.B. durch Beziehungen und Identitäten, die in Interaktionen entstehen); intersubjektive (unmittelbar gemachte) Erfahrungen und Beziehungsdynamiken; (fortwährende) Sinn- und Bedeutungskonstruktionen in Interaktionen
Methoden
Vorwiegend quantitative (Fragebogen-) studien oder Experimente; statistische Variablen basierte Modellierungen und hypothesentestende Designs
Vorwiegend qualitativ interpretative Ansätze, wie ethnographische Feldforschung, interpretative Grounded Theory, narrative Ansätze, Diskursanalyse, Aktionsforschung; interaktionsorientierte und kontextsensitive dynamische Designs zur reichhaltigen Deskription und/oder Theoriebildung
Ergänzungen Positivismus - dominante Form der theoretischen Begründung von Wissenschaft - Gültigkeit sollte nur noch haben was positiv demonstrierbar ist und sich in konkreten Messdaten widerspiegelt → alles andere wurde zur Spekulation und als unwissenschaftlich erachtet - abgeschwächt im Postpositivismus
5
Ergänzungen sozialer Konstruktionismus - intersubjektive Prozesse - relativistische Zwischenposition zwischen Objektivität und Subjektivität Traditionelle empirische Kriterien guter Forschung und die sozial konstruktionistische Kritik Bleige persönlich und distanziert: - Ziel guter empirischer Forschung ist es, die Welt darzustellen, wie sie ist. Gefordert ist leidenschaftslose Distanz zum Forschungsgegenstand.
Die sozial konstruktionistische Antwort: - selten ohne Grund geforscht - Forschung ist immer interessengeleitet und dies sollte nicht hinter einer neutralen Sprache verborgen werden
Kontrolliere die Bedingungen: - Modell von Ursache und Wirkung
Die sozial konstruktionistische Antwort: - Modell von Ursache und Wirkung wird als wahr akzeptiert allerdings verabschieden wir uns vom Konzept menschlicher Handlungsfreiheit samt der humanistischen Tradition
Überführe Beobachtungen in Zahlen: - gelten verbale Beschreibungen üblicherweise als zu plump - Überführung in Zahlen lässt sich eine Präzision erzielen - Zahlen haben keine subtilen Konnotationen von gut oder schlecht
Die sozial konstruktionistische Antwort: - Überführung von Sprache in Zahlen wird es keineswegs präziser - lediglich anderes Übersetzungsmedium - meistens geht verloren, was Menschen als (emotional) bedeutungsvoll erachten
Suche nach der Antwort: - eine wahre Antwort auf jede Frage finden
Die sozial konstruktionistische Antwort: - Im Versuch nur auf eine einzige Stimme zu hören liegt eine enorme Unterdrückung von Potenzial
Trenne Wahrheit und Praxis: - Ziel, Theorien mit einem möglichst breiten Gültigkeitsanspruch und möglichst universellen und nicht auf bestimmte historische Situationen beschränkte Aussagen zu entwickeln. - Die Erforschung spezifischer Praktiken ist von geringem wissenschaftlichen Wert, da diese weder verallgemeinerbar noch überdauernd sind.
Die sozial konstruktionistische Antwort: - Daten können nie beweisen, dass eine Theorie wahr oder falsch ist - individualistische Sicht wird abgelehnt → soziale Sicht
Grundelemente qualitativer Forschung und Methodik - alltags- und lebensweltliche Phänomenen, Probleme und Prozesse sowie Ausdruck der Sichtweisen der involvierten Akteuere
6
-
Datenerhebung durch Feldbeobachtungen, Gespräche üblicherweise in Textform überführt Auswertung der Daten als interpersonal-kommunikatives “Verstehen” Ziel mit der Entdeckung von Neuem (kreativer Prozess) Beteiligung der Forschenden wird reflektiert reflexiv mit den (Vor-)Annahmen bezüglich der Charakteristika des u untersuchenden Phänomens
→ Im Bezug auf Führungsforschung sind die Ansätze relevant, die in der Lage sind, Führung als Prozess und als soziales Phänomen zu untersuchen → qualitative Forschung ist gut geeignet um Phänomene und Probleme aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben und so eine alternative Sicht- und Denkweise zu entwickeln
Hinführung Der Prozessbegriff -
-
-
Prozessperspektive/ Prozess-Studien: Entwicklungen, Veränderungen (Changen) oder Vorgänge über eine mehr oder minder eingegrenzte Zeitspanne zu untersuchen Entwicklungsverläufe sind nicht immer linear sondern beispielsweise rekursiv oder zyklisch angestrebten Ergebnisse sind dann Prozesstheorien, die von Varianztheorien (→ haben mit Variablen zu tun), Prozesstheorien fokussieren daher - anstelle von Variablen - auf Events, also Geschehnisse oder Vorkommnisse Prozess-Ontologie: Organisation nicht als etwas substantielles Existentes sodern ständig weiterentwickelndes → zeitliche Dimensionen (NichtLinearität, Rekursitivität → Emergenz werden anerkannt) Seins-Ontologie: Substanzen aus stabilen Materialien, existieren unabhängig voneinander, Subjekt-Prädikat-Struktur unserer Sprache
Auslegung des Prozesskonzepts -
es steht nicht von vornherein fest, wer führt und wie sich Führung ggfs. entwickelt von einer a priori Festlegung der Führungs- und Geführtenrolle abgesehen Fokus liegt auf den Interaktions- und Beziehungsprozessen Entstehung von Führung ( --> Emergenz von Führerschaft) und auch informeller Führung funktionale Differenzierung von Rollen innerhalb von Gruppen (aufgabenorientierter Führung und beziehungsorientierter Führer)
Shared Leadership als Prozess - dynamische und interaktive Einflussprozess zwischen Gruppenmitglieder, bei dem sich die Gruppenmitglieder gegenseitig führen
7
-
Teilung von (Führungs-)aufgaben zur Steigerung der Effektivität von Teams Führungsprozess als ganzheitliches organisationsweites Phänomen
Theoretische Grundlagen Relationen und Beziehungen (Relational Turn) Relation: Beziehung oder Verbindung zwischen zwei oder mehr Größen Relata: Bezugspunkte von Relationen in struturalistischen Betrachtungen (“space between”) Relationen: Bsp. in Form von Wirkungsbeziehungen, Kräfteverhältnissen, Abhängigkeiten Relationship: Beziehung Relationality: Zustand, “In-Beziehung-Sein” Relational: Attribut Relationismus: Alle Dinge und Handlungssubjekte sind nur Ausdruck von Beziehungen Individualismus: Gesellschaftliche Zusammenhänge und Entwicklungsprozesse sind allein auf das Handeln von Individuen zurückzuführen Idealismus: Ideen sind Haupterklärungsfaktoren menschlichen Handelns bzw. Haupttriebkräfte gesellschaftlicher Entwicklung relationale Führung - Im Blick steht vielmehr das Geschehen - vorrangig geht es um die Dynamiken des Relationalen sozialer Konstruktionismus bildet das theoretische Fundament für den Relational Turn - sozial konstruktionistische Ideen zum Selbst und des Anti-Individualismus - Selbst ist somit nicht als etwas Naturgegebenenes anzusehen, sondern als das Produkt sozialer und kultureller Prozesse sowie der sozialen Beziehungen und Kontexte - Interaktionen, Beziehungen, kommunikative Praktiken - Bedeutung der Sprache als Form des sozialen Handelns - eine Form des sozialen Handelns durch das Wirklichkeit mit erschaffen wird - Begriffe sind soziale Artefakte (aus historischem und kulturellem Hintergrund) - in Sprachspiele von Gemeinschaften festgelegt - “Die Bedeutung eines Wortes ist seine Verwendung in der Sprache” - Abschied von binärer Logik (wahr/ falsch) - Vielfalt an Bedeutungen - kulturelle Kontexte und dieser gibt Sinn Konzeptbegriff - Konzepte, die nur auf der Basis von Interaktionen mit anderen Menschen und der Umwelt, des Kontextes entwickelt und verstanden werden können - interaktionale Eigenschaften sind nur im Hinblick auf die menschliche Daseinsgestaltung sinnvoll Sprache
8
-
aktiv gestaltende Kraft performativer Charakter (wirklichkeitsschaffende Kraft) Bedeutung des Dialogs (nicht Gesprche im Allgemeinen sondern spezielle Arten von Beziehungen in denen Veränderung, Wachstum und neue Einsichten gefördert werden) → gemeinsam Neues erschaffen
Unterscheidung Konstruktivismus - Sozialer Konstruktionismus Konstruktivismus Annahmen über die Realität (ontologische Grundposition)
-
Annahmen über Erkenntnis und Wissen (epistemologische Grundposition), hier insbes. die Frage nach der Quelle der Wirklichkeit
-
Forschungsfokus
-
-
Sozialer Konstruktionsimus
keine Welt (Realität) außerhalb des Subjekts Wirklichkeit wird erzeugt
-
soziale Wirklichkeit existiert nicht unabhängig vom Individuum
subjektive Wahrnehmnung
-
gesellschaftlich, kulturell, historisch und diskursiv beeinflusst relativistische Position zwischen Objektivität und Subjektivität
-
individuelle Wahrnehmung
-
Intersubjekte sozialer Wirklichkeit (Interaktionen, Beziehungen)
Fakten und soziale Wirklichkeit - Fakten (z.B. naturwissenschaftlich technische Daten) durchaus als objektiv vorhanden angesehen - für soziale Phänomene nicht der Fall - soziale Wirklichkeit ist im Sinn und den Interpretationen zu verordnen
Praxis (Practice Turn) - Praxisbasierte Organisationsanalysen - “Strategy-as-Practice” ( - Gemeinsames Fundament ist üblicherweise der soziale Konstruktionsimus Hintergrund - Praktiken formieren sich aus einem komplexen sich organisierenden Bündel von Tätigkeiten, einschließlich verbaler und nichtverbaler Akte - unbewusste Dimensionen kommen zum tragen - alltägliche Akte - dahinterliegende Strukturen (Substruktur) - fokussiert geteilte praktische Verständnis de Akteuere - soziale Strukturen (Makro-Ebene) und menschliches Handeln (Mikro-Ebene) - Kritik an Individuenzentriertheit
9
-
Fokus auf moralische, emotionale und relationaler Aspekte, anstelle rationaler, objektiver und technisch-fachbezogenen Aspekte weniger für die individuellen und heldenhaften Führungsaspekte sondern mehr für die organisierte Führungsarbeit inhärent kontextsensitiv (Berücksichtigung des Kontextes von vorneherein mit enthalten
Anwendungsfelder und empirische Konkretisierung Distributed/ Shared Leadership in Teams -
Sammelbegriff der pluralen Führung interaktiver Einflussprozess Ziel sich gegenseitig zu führen neben traditioneller vertikaler Führung positiver Einfluss auf Leistungsergebnisse
Empirische Befunde Shared Leadership - vertikale also auch verteilte Führung hatten einen positiven Einfluss zum Leistungsergebnis - verteilte Führung zu Performance Variablen höher - höher wahrgenommene kollektive Selbstwirksamkeit und in Form eines stärker entwickelten Transaktiven Gedächtnisses - geringeres Maß an Beziehungskonflikten und förderlich für Teameffektivität - motivationale Vorteile, kognitive Vorteile (stärkeres transaktives Gedächtnis) Einflüsse für die Entstehung von Shared Leadership - kognitive Fähigkeiten - emotionale Kompetenz - gemeinsam geteilte Ziele - Gruppengröße - Bestandsdauer des Teams - Voraussetzungen - gemeinsam geteilte Orientierungen, Werte und Einstellungen - Teamorientierung - Aufgabencharakteristika (Aufgabenkomplexität und Interdependenz) - positives internes Teamklima (gemeinsames Verständnis über Teamziele) - externe Unterstützung durch Teamcoaching - hoher Abstimmungsbedarf - Problematik von Kommunikation bei Macht- und Statusunterschieden (Aufwärtskommunikation!) → Stillschweigen und Phänomene der Schmeichelei, Bei Kritik reagieren Vorgesetzte mit Restriktionen (Ignoranz, Ablehnung)
10
Shared Network Leadership -
kooperatives Unternehmensnetzwerk (interorganisationales Netzwerk) gleichberechtigte Teilnehmer (keine formalen Leitungsfunktionen) geeignet, um gemeinsam geteilte Führungsprozesse und ihre kommunikations- und beziehungsbezogenen Entstehungsprozesse zu erklären
Methode Grounded Theory -
-
Im Ergebnis kontextsensitive und gegenstandsnahe empirisch verankerte theoretische Konzeptualisierungen - daher auch als “grounded theory” bezeichnet zum Vorschein kommen quantitative Forschung wird hier ausdrücklich nicht angestrebt
Forschungsprozess -
zwischen Daten und Theorie (Literatur) wird hin- und hergependelt Induktive, d.h. aus den empirischen Daten entwickelte und deduktive, d.h. aus der Theorie entwickelte Konzeptbildung wechselt sich ab (analytische Induktion)
Dialog Ansatz - am weitesten entwickelten Qualitätsstufe als “generative dailogue” - relationales Phänomen - gemeinsam geteilter sozialer Einflussprozess - Aufmerksamkeitsverschiebung weg vom Individuum - gemeinsames Lernen und Verantwortung - gemeinschaftliche Führung
11
Stufenmodell der Entwicklung von Shared Leadership Höflichkeitsphase - bedachte Kommunikation - inspirierendes Rahmenangebot (z.B.: Impulsreferate, Betriebsrundgänge, Ausstellungs besuche) - lenförderliche Umgebung - Überformalisierung vermeiden - umfangreiche Feedbackschleifen entwickeln - kollektive Meinungsbildung - Moderatoren unverzichtbar Debatte - persönliche Standpunkte und Ideen - Suche nach neuen Lösungen und Regeln - Spannungen und Konflikte - Perspektivenvielfalt erlauben - Verhandlungsmodus aufgeben - gemeinsam Neues ergebnisoffen erkunden Reflektierenden Dialog - eigene Einstellungen, Meinungen und die eigene Situation wird kritisch hinterfragt - Vertrauen und gegenseitige Verpflichtung nehmen zu - intensiver Austausch - gemeinsame soziale Lernprozesse - selbstkritische Gesprächshaltung - offene Fragen - Denken in Möglichkeiten (versus Gewissheiten) - respektvoller und wertschätzender ...
Similar Free PDFs

Beispiel Zusammenfassung
- 49 Pages

Werbespotanalyse Beispiel
- 11 Pages

Metafrage - Beispiel
- 3 Pages

Beispiel Präsentation
- 22 Pages

Verhaltensvertrag Beispiel
- 2 Pages

Überzeugungsrede Beispiel
- 3 Pages

Beispiel Expose
- 3 Pages

Exzerpt beispiel
- 2 Pages
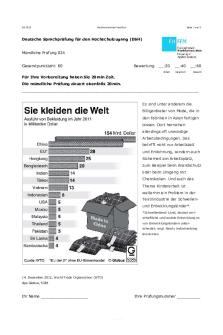
Mündliche Prüfung - Beispiel 4
- 2 Pages

CRC-Beispiel - Übung
- 2 Pages

Beispiel eines Statements
- 3 Pages

GIF Beispiel Prüfung 2015
- 22 Pages

Vigenere-quadrat-beispiel
- 2 Pages

FOM Seminararbeit Beispiel
- 18 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu

