Transport - alles PDF

| Title | Transport - alles |
|---|---|
| Author | Raul Weidner |
| Course | Unternehmensführung |
| Institution | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg |
| Pages | 23 |
| File Size | 907.1 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 98 |
| Total Views | 168 |
Summary
alles...
Description
Transport- und Verkehrslogistik (TVL)
Klausur 09.01.20
1. Grundlagen der TVL Bedeutung der Verkehrslogistik: Verkehrsaufkommen: Menge, der in einem bestimmten Zeitraum außerhalb von Produktionsstandorten beförderten Güter. Maßgröße: Tonnen, Wege
Verkehrsleistung: Produkt aus Verkehrsaufkommen und zurückgelegter Wegstrecke. Maßgröße: Tonnenkilometer, Personenkilometer
Modal Split: Aufteilung des Verkehrsaufkommens oder der Verkehrsleistung nach Verkehrsträgern.
Gründe für den Rückgang des Verkehrsaufkommens bei gleichzeitigem Anstieg der Verkehrsleitung: Güterstruktureffekt: Wandel der Güterstruktur dahingehend, dass: Die Sendungsgrößen mehr und mehr sinken Der Massengutverkehr zugunsten des Stückguttransports an Bedeutung verliert Die Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen zunehmen Verpackungsaufwand Steigt Der Wert der Güter pro Gewichtseinheit zunimmt
Logistikeffekt: Neuere Logistikkonzepte der Industrie bzw. der Verlader: o Beschaffung: JIT / JIS Anlieferfrequenzen steigen o Distribution: Zentralisierung Veränderte Produktionsprozesse infolge der Globalisierung o Geringere Fertigungstiefen => Verkehre zwischen Zulieferern und Produzenten werden weiter zunehmen.
1
2. Akteure der Transport- und Verkehrslogistik Entwicklung der Spedition: 1 PL: (First party Logistics Model) Werkslogistik-Leistungen warden durch spezialisierte (unternehmensinterne) Dienstleister erbracht Eigenes Equipment und eigenes Personal.
2 PL: (Second Party Logistics Model) Übernahme von Transport-, Umschlag- und Lagerleistungen (TUL-Leistungen) durch (unternehmensexterne) Dritte Klassischer Spediteure
3 PL: (Third Party Logistics Model) Übernahme komplexer logistischer Leistungspakete durch Dritte (z.B. Kontraklogistik) Outsourcing Partner; Oft: eigenes Netzwerke, Technologien (z.B. K + N) z.B. Übernimmt auch Montagetätigkeit
4 PL: (Fourth Party Logistics Model) Steuerungung komplexer logistischer Netzwerke durch Dritte Netzwerkintegrator, Logistikbroker
Kennzeichen 4 PL: Planung der Logistikketten und Netzwerke für den Verlader. Auswahl geeigneter Logistikdienstleister und Übernahme der Steuerungs-, Koordination und Überwachungsaufgaben der Supply Chain (2 PL und 3 PL)
Neutralität => Keine Logistik – Assets, d.h. keine Warehouses (nur Beratung) Vorteil: Er bindet sich an keinen Kapital Nachteil: Man braucht immer eine 3 PL Aktuell: 4 PL nur noch Theorie - LLP – Konzept (Lead Logistics Provider) in der Praxis Kombination der traditionellen Aufgaben eines 3PL mit den Funktionen eines 4PL Koordination von Dienstleistern und Lieferanten in der Wertschöpfungskette. „Menge-in-Transit“: Zusammenführung von Direktlieferungen in statistischen/dynamischen
2
Umschlagspunkten, um Bestände zu reduzieren und eine zeitgleiche Anlieferung mehrerer Güter verschiedenen Ursprungs zu ermöglichen. 1. Ein Kunde bestellt mehrere Produkte verschiedener Lieferanten 2. Die Bestellung wird allen Lieferanten/Verladestellen zugeordnet 3. Lieferfähigkeit wird bestätigt. 4. Konsolidierung an einem fallabhängigen Punkt 5. Sammelladung an den Kunden Beschleunigung des Güterflusses und Reduzierung der Anzahl an Lagerstufen Maximierung von Konsolidierungseffekten bei der Vergabe von Frachtvolumina Systematische Kontrolle der Frachtabrechnungen Transparenz und „event-gesteuertes“ Störfallmanagement, um Abweichungen zu erkennen und proaktiv korrekt Maßnahmen einzuleiten.
Transport Optimization
Potenziale: 1. Load Building (Bestellbündelung): Prüfen des Konsolidierungspotenzials 2. Carrier Selection (Betreiber-/Spediteur-Auswahl): Suche nach dem billigsten Spediteur, dem es möglich ist die Leistung zu erbringen. 3. Routing (Routenführung): Suche nach der am billigsten realisierbaren Routenführung (Route, Anzahl und Reihenfolge der Stationen)
4. Hubs (Knotenpunkte): Optimierung der Hub-Strategie
3. Verkehrsträger in der TVL: 3.1.
Straßengüterverkehr
Technische Mittel zum Transport im Straßengüterverkehr: Palettenstellplätze auf ausgewählten Fahrzeugen. Palettenstellplatz: Palettengrundfläche 80 x 120 cm; Je nach Höhe des jeweiligen LKW kann das Volumen variieren.
Lademeter: Bezug: gesamte Breite und Höhe des LKW, sowie die beanspruchte Länge der Ladefläche in Meter
o Lastzug mit Normalaufbau: 35 Paletten (Motorwagen 3 x 5 = 15 Paletten und Anhänger 2 x 10 = 20 Paletten)
o Sattelzug mit Normalaufbau: 33 Paletten (3 x 11 Paletten) Gigaliner – Chancen und Risiken: Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit Überlänge (bis zu 25,25 m)
Chancen: o Entlastung der Infrastruktur Weniger Last pro Achse Viel Volumen und wenig Gewicht Mehr Platz weniger Staus o Entlastung der Umwelt Reduzierung der CO2-Emissionen um bis zu 30% Reduzierung des Rußpartikelausstoßes um bis zu 30% o Kosteneinsparung Reduzierung des Dieselverbrauchs um bis zu 30%
Risiken: o Vorsicht bei Überholen 3
Durch die Länge erhöht sich die Überholzeit und damit das Sicherheitsrisiko
o Parkplätze und Nothaltebuchten zu kurz/klein Ordnungspolitische Normen: Gesamtheit der Regelungen, die Festlegen, unter welchen Voraussetzungen und Bedienungen Straßengüterverkehr zu erfolgen hat.
Regelung in erster Linie im Güterkraftverkehrgesetz (GÜKG); ergänzend gibt es dazu eine Reihe von Verordnungen, z.B.: Berufszugangsverordnung, Erlaubnisverordnung, VO über den grenzüberschreitenden Güterverkehr und den Kabotageverkehr o Harmonisierung (z.B. Angleichung der Wettbewerbsbedingungen) o Liberalisierung (z.B. Abschaffen von Begrenzungen)
Marktordnung der Güterkraftverkehrs in der Bundesrepublik Deutschland:
Marktzugang
Mitzuführende Unterlagen
Gewerblicher Güterkraftverkehr Erlaubnispflicht Keine Kontingentierung (wenn Kriterien erfüllt werden, muss Erlaubnis erteilt werden) Erlaubniserteilung aufgrund subjektiver Berufszugangsvoraussetzungen: o Persönliche Zuverlässigkeit o Fachliche Eignung o Finanzielle Leistungsfähigkeit Erlaubnisurkunde (Kopie) Versicherungsbestätigung (Güterschadenhaftpflichtversicherung) (Kopie) Nachweis, auf dem der Auftraggeber, die beförderten Güter sowie der Be- und Entladeort ersichtlich sind (Begleitpapier, Frachtbrief, etc.)
Werkverkehr Keine Erlaubnispflicht Keine Versicherungspflicht Anmeldung des Unternehmens (vor der ersten Beförderung), wenn der Werkverkehr mit LKWs, Zügen (LKW + Anhänger) und Sattelkraftfahrzeugen mit einem Gesamtgewicht > 3,5 t erfolgt Keine Vorschrift zur Mitführung von Beförderungs- und Begleitpapieren Es empfiehlt sich jedoch bei Straßenkontrolle eine Kopie der Anmeldung zum Werkverkehr im Fahrzeug mitzuführen
Überwachung durch das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) durch Straßenkontrollen und Betriebsprüfungen
Marktordnung im Internationalen Güterkraftverkehr: Territorialitätsprinzips: Grenzüberschreitende Beförderungen Genehmigungen: o Transportgenehmigung/Bilaterale Genehmigung o EU-Lizenz o CEMT-Genehmigung Straßenverkehrsrechtsvorschriften: Autobahnmautgesetz: Seit 1.Januar 2005: Erhebung einer entfernungsabhängigen Gebühr (Maut) für die Benutzung der Autobahnen (Autobahnmautgesetz für schwere Nutzfahrzeuge (ABMAG); für alle LKWs mit höchstzulässigem Gewicht ab 12 t) Seit August 2012: Bemautung vierspuriger Bundesstraßen, die an eine Bundesautobahn angeschlossen sind. 4
Seit Juli 2018: Mautpflicht auf allen Bundesstraßen Aktuelle Lage (ab Januar 2019): Teilmautsätze o Teilmaut für Infrastruktur (Gewicht und Anzahl der Achse) o Teilmaut für externe Kosten der Luftverschmutzung (Schadstoffklasse) o Teilmaut für externe Kosten der Lärmbelästigung Höhe der Maut wird bestimmt durch: o Die Schadstoffklasse o Die Anzahl der Achsen (bis zu 3 bzw. ab 4) Automatisches Verfahren: 2 Möglichkeiten der Bezahlung o Prepaid (Internet oder Toll-Point-Automat) o Postpaid (Onboard-Unit) Kontrolle durch BAG und Zollbehörden Sozialvorschriften: Lenkzeit: 9h Fahrunterbrechung: 45 min/15 und 30 min Ruhezeit: 11h / 3 und 9h
Produkte KEP (Kurier-, Express- und Paketdienste): KEP-Dienste sind eine Art „schnelle Dienste mit kurzen und meist auch garantierten Laufzeiten“
Netzwerktypen im KEP-Markt: Direktverkehrsnetz: o Auch Point-to-point genannt o Einfachster Netzwerktyp o Vor allem von Stadtkurierdiensten genutzt o Gelegentliche Nutzung von national und international tätigen Expressdiensten (bei besonders zeitkritischen Transporten)
Multistopp-Netzwerk: o Auch milk-run genannt o Vernetzung von Abhol- und Zustellprunkten je Fahrzeugbündelung
o Beispiel: Apothekenbelieferung durch DPD, klassische Post und im Bereich des Teilladungsverkehrs.
Depot-Netzwerk: o Ein Depot pro Region für Sammel- und Verteilverkehre o Durch die Konzentration der Verkehre auf Depots reduziert Sich die Anzahl der Verbindungen zwischen den einzelnen Versand- und Empfangspunkten von Sendungen o Hohe Sendungszahlen erforderlich, um die mit der Umschlags und Bündelungsfunktion des Depots. Verbundenen Optimierungsmöglichkeiten zu nutzen. 5
Hub-and-spoke-Netzwerk: o Struktur erinnert ein Wagenrad mit zentraler Nabe und Mehreren Speichen. o Lieferung der Sendung aus den Speichen (regionale Umschlagsdepots) in der Nacht in das Hub; dort werden die Sendungen nach Zielen sortiert und dann sternförmig in die Speichen befördert o Bei Paket- und Express-DL am weitesten verbreitet
Informationsflussgestaltung: Tracking & Tracing Systeme: Tracking: Auffinden des einzelnen Pakets Während des Transports Tracing: Nachvollziehbarkeit des Paketflusses Nach dem physischen Transport Funktionsweise: Status 1: Paket ist im Abholdepot Status 2: Paket ist im Hub Status 3: Paket ist im Auslieferdepot Status 4: Paket ist auf dem Nahverkehrsfahrzeug Status 5: Paket ist ausgeliefert
Sammelgut/Stückgut: Ziel/Zweck:
Flächendeckender Transport von Stückgutsendungen in einer Region (z.B. Deutschland) Mit einer definierten Servicezeit von 24h Zu akzeptablen Preisen Und geringen Kosten
Prozesse:
Vorlauf:
6
Transport von Einzelsendungen verschiedener Versender zur Umschlagshalle des Versandspediteurs (VSp) (per Direktfahrt oder Sammeltour) Selbstanlieferung (Verlader) Abholung durch eigene Fahrzeuge oder Unternehmerfahrzeuge ( Einzugsgebiet) Regelfall: Abholung o Unterteilung des Einzugsgebiets in Zonen o Unterteilung der Zonen in Gebiete in Abhängigkeit von (Gebietsgröße, Anzahl der
Kontraktkunden, durchschnittliche Sendungsaufkommen)
Umschlag VSp:
Entladung der Nahverkehr-Fahrzeuge Schnittstellenkontrolle „Zwischenpuffern“ der einzelnen Sendungen auf den jeweiligen Relationsplätzen Wichtig: Planung der Relationsplätze und der Raumbelegung sowie die Erarbeitung geeigneter Personal- und Arbeitszeitmodelle.
Administration VSp:
Büromäßige Erfassung und Weiterverarbeitung der Sendungen für die weitere Verfügung (Erstellung: Bordero etc.) Übermittlung der sendungsbegleitenden Daten per Datenfernübertragung (DFÜ) an der ESp
Umschlag und Administration ESp:
In der jeweiligen Stückgutspeditionsanlage/Verteilzentrum/Hub/Crossdock Umschlag in der Umschlagshalle Meist genutzte Grundform „Shapes“ (im 2-Schicht-Betrieb) = I-Shape (Sonstige: Q, T, U, L)
Hauptlauf:
Stets per 40 Tonner (Sattel- oder Wechselbrückenfahrzeug) im sog. Nachtsprung (Abends losfahren um am nächsten Tag, spätestens um 5 Uhr, anzukommen) Linienverkehr ohne Umschlag 1. Direktverkehre: Sinnvoll bei Kürzeren Strecken zwischen VSp und ESp und wenn Aufkommen zwischen VSp und ESp voneinander unabhängig 2. Rundlaufverkehre: Sinnvoll bei kurzen Strecken zwischen VSp und ESp und bei ähnlich hohem Aufkommen Voraussetzung: Einigung, wer die Touren übernimmt oder bei Aufteilung entsprechende Vereinbarung 3. Begegnungsverkehre: Sinnvoll bei weiten Strecken zwischen VSp und ESp und bei in etwa gleich hohem Aufkommen Voraussetzung: gleiches Equipment 4. Hub-Verkehre: Sinnvoll bei „Überhängen“ (wenn LKW voll, aber noch was da) oder bei „Mindermengen“ (wenn LKW relativ leer) Voraussetzung: Systemkonforme Sendungen (z.B. nicht Standardmaß); Einhaltung diverser Regeln (Hub-Vorgaben) (z.B. pro Relation x Lademeter)
Abrechnung VSp – Kunde: Ziel: einfache Abrechnungsgrundlage Übernahmesatz
Spotgeschäft (einmaliger Kunde): bestimmter €-Betrag Kontraktgeschäft (regelmäßiger Kunde): Haus – Haus – Entgelte
Häufigste Abrechnungsgrundlagen: 7
Haustarife
Tarife für den Spediteursammelgutverkehr (BSL – Bundesverband Spedition und Logistik)
Berechnung der Haus-Haus-Entgelte: Nach Entfernung und frachtpflichtigem Gewicht Ermittlung des frachtpflichtigen Gewichts nach den folgenden Kriterien: Mindestgewicht von 400 Kg pro Palettenstellplatz Mindestgewicht von 200 Kg pro stapelbarer FP (Flachpalette) Mindestgewicht von 250 Kg pro stapelbarer GiBO Mindestgewicht von 1000 Kg pro Lademeter Sperrigkeitsregelung von 200 Kg pro m 3 (bzw. 2 Kg pro angefangene 10 Beispiel: Sendungsgewicht = 45 Kg, beanspruchter Laderaum = 1.381 dm 3 (1.390 dm 3 x 2 Kg) / 10 dm 3 = 278 Kg (frachtpflichtiges Gewicht)
dm
3
)
Teilladung: Direkter Teilladungsverkehr: Gütertransport von mehreren Versendern zu mehreren Empfängern die zwischenzeitlichen Umschlag Indirekter/gebrochener Teilladungsverkehr: Variante 1: VOLLSTÄNDIG gebrochener Teilladungsverkehr o Jede Teilpartie (TP) wird mindestens einmal umgeschlagen o Umschlagort i.d.R. beim Versandspediteur (VSp) Variante 2: TEILWEISE gebrochener Teilladungsverkehr o Mindestens eine Teilpartie wird direkt, mindestens eine Teilpartie wird indirekt befördert o Je nach Frankatur erfolgt die Konsolidierung entweder beim VSp oder beim ESp
Abrechnung:
Bei Spotgeschäften (einmaliger Kunde): über Tagespreis Zusätzliche Einflussfaktoren ggnü. Komplettladung Benötigte Stellplätze Frachtpflichtiges Gewicht (Sammelgut) Kombinationsmöglichkeiten aus Verladetag Bei Kontraktgeschäften (regelmäßigen Kunden): durch Relationen-Preise mit bestimmter Bindungsdauer (auf Basis von Durchschnittswerten) und zusätzlicher Vereinbarung von sog. Dieselpreisklauseln
Der Dieselpreis macht ca. 20 – 25% des Gesamtpreises aus Dieselpreisgleitklauseln: Ziel: Weiterbelastung gestiegener Dieselpreise an den Kunden (ohne langwierige Debatten) 8
Funktionsweise: Ausgangsbasis: Anteil der Kraftstoffkosten an den Gesamtkosten Variabler Dieselzuschlag ergibt sich aus Multiplikation der Dieselpreisänderung zum Vorjahr mit dem Kostenanteil des Diesels an den Gesamtkosten
1 – 0,95 / 0,84 = 0,13
25% x 13% x 100 = 3,25%
Fahrzeugkostenberechnung SZM Plane Abnutzung (z.B. 50%) + Treibstoff + Schmierstoff + Reifen + Reparatur + sonst. Betriebskosten Km-abhängige Kosten 1: (WBP /ND) / 100 * 50% 2: (km-Leistung p.a. / 100)* (Literverbrauch / 100 )* Durchschnittspreis 3: Km-Leistung /Laufzeit der Reifen * Anzahl der Reifen * Einzelpreis Reifen Fahrerlohn + Urlaubsgeld + Aushilfe + Soz. Aufw./Lohnnebenkosten (24%) + Spesen + Urlaubsvertretung + Lohnnebenkosten Vertretung (24%) + Spesen Vertretung Fahrpersonalkosten 9
Auflieger Plane 1 2 3
4
4: Fahrerlohn + Urlaubsgeld + Aushilfe * 24% Entwertung (50%) + Zins (z.B. 11,5%) + KFZ-Steuer + Versicherungen Feste Fahrzeugkosten 5: Abnutzung 6:Betriebsnotwendiges Vermögen * 11,5% Fahrpersonalkosten + Feste Fahrzeugkosten Zeitabhängige Fahrzeugkosten Zeitabhängige Fahrzeugkosten + Km-abhängige Fahrzeugkosten Fahrzeugeinsatzkosten Allgemeine Verwaltungskosten (3%) + Unternehmerlohn (10%) + Unternehmerrisiko Gemeinkosten 7: Bezugsgröße = Fahrzeugeinsatzkosten Fahrzeugeinsatzkosten + Gemeinkosten Gesamtkosten
5 6
7 7 7
Fahrzeugkosten pro Km Km-abhängige Fahrzeugkosten + Gemeinkosten Zuschlagssatz Km-Abh. Fahrzeugkosten einsch. GKAnteil 8: Bezugsgröße = km-abhängige Fahrzeugkosten Km-Abh. Fahrzeugkosten einschl. GK Anteil / Km-Leistung pro Jahr Fahrzeugkosten pro km
8
Fahrzeugkosten pro Einsatztag Zeitabhängige Fahrzeugkosten + Gemeinkosten Zuschlagsatz Zeitabh. Fahrzeugkosten einschl. GK Anteil 10
9
9: Bezugsgröße = Zeitabhängige Fahrzeugkosten Zeitabh. Fahrzeugkosten einschl. GKAnteil / Einsatztage im Jahr Fahrzeugkosten pro Einsatztag
Km-Leistung pro Jahr / Einsatztage im Jahr X Fahrzeugkosten pro Km + Fahrzeugkosten pro Einsatztag Gesamtkosten inkl. GK pro Einsatztag
Logistik 4.0 4.0 steht für eine umfassende Informatisierung der Logistikbranche mit ihren Akteuren und Objekte
Einbindung der Akteure in System; Digital auf verschiedenen Geräten, damit die Akteure Infos zu Sendungen und Produkten abfragen und Steuerungen von Abwicklungen in Logistikzentren
Vision: o o o o o
Autonome und sich selbst regulierende Lieferketten, in der der Mensch nur noch administrative Aufgaben hat LKW soll künftig am Betriebsgelände selbstständig mit den von Systemen ermittelten Materialien beladen werden Auslieferroute wird automatisch auf Basis von Echtzeitdaten ermittelt LKW liefert Ware am Bestimmungsort aus (ohne Eingreifen des Fahrers) Entladung erfolgt ebenfalls automatisiert mit Hilfe von Robotern und autonomer Fördertechnik
Ziele: o o o o
Unternehmensübergreifende Automatisierung und Optimierung der logistischen Prozesse Verbesserte Ressourceneffizienz Flexibilisierung der Lieferkette Erzielung von Wertschöpfungspotenzialen durch neue Dienstleistungen und Einbeziehung individueller Kundenwünsche
Autonomes Fahren und Plattoning: Megatrend der externen Logistik Unterteilung folgender Levels (BASt = Bundesamt für Straßenwesen) Level 0: Drivers only (Fahrer allein steuert und regelt die Geschwindigkeit) AKTUELL Level 1: Assistiert (Assistenzsysteme unterstützen der Fahrer) Aktuell Level 2: Teilautomatisiert (Unterstützung z.B. durch automatisches einparken) Teilw. Aktuell Level 3: Hochautomatisiert (Fahrer muss nur noch überwachen und im Notfall eingreifen) Unternehmensintern Teilweise Aktuell Level 4: Vollautomatisiert (Führung wird dauerhaft vom System übernommen) Nicht Aktuell Level 5: Autonomes Fahren (Kein Fahrer erforderlich; nur zum starten des Systems und zur Zieleingabe) Nicht Aktuell 11
Praxisbeispiel: Umsetzung von Wechselbrücken auf Betriebsgelände Platooning: o LKWs fahren in einem geschlossenen Verband dicht hintereinander o Erster LKW übernimmt die Regelung der Geschwindigkeit und der Fahrtrichtung o Nachfolgende LKWs werden mit dem Führerfahrzeug per Kommunikationsschnittstelle verbunden
o Mit Hilfe eines technisches Steuerungssystems können die Fahrzeuge in einem Abstand von 3 Sekunden bei einer Geschwindigkeit von 80 Km/h hintereinanderfahren Vorteile: Kraftstoffersparnis (ca. 2%), Verkehrssicherheit leidet nicht
Voraussetzungen/Problemstellungen: o o o o
3.2.
Gleicher Start- und Endpunkt nahe Autobahn nötig Bei Abfahrt von Autobahn wird Fahrer benötigt Frage: Wer ist der erste ? (nur die dahinter profitieren) Wenn nicht unternehmensintern, sondern mit Konkurrenz ist Kommunikation schwierig
Eisenbahngüterverkehr:
Innerdeutsch zweitwichtigster Verkehrsträger (Verkehrsaufkommen und -Leistung) Abstände zum Straßengüterverkehr enorm Hauptgründe dafür:
Güterstruktureffekt und Logistikeffekt (Massengüter verlieren ständig an Bedeutung) Hohe Anteile der Bahn in...
Similar Free PDFs

Transport - alles
- 23 Pages

Samenvatting - college Alles, compleet
- 167 Pages

Pijnmanagement - Samenvatting alles
- 107 Pages
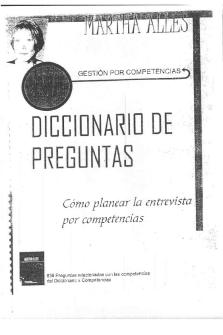
Diccionario de Preguntas Alles
- 199 Pages

Casussen alles coa
- 22 Pages

Hoofdstuk 13 - alles samengevat
- 2 Pages

Resumen del Libro M Alles
- 62 Pages

Zusammenfassung Grundrechte alles
- 27 Pages

Martha Alles - Autoevaluacion
- 12 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu






