Zusammenfassung Grundrechte alles PDF

| Title | Zusammenfassung Grundrechte alles |
|---|---|
| Course | Grundrechte |
| Institution | Universität Bayreuth |
| Pages | 27 |
| File Size | 564 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 4 |
| Total Views | 129 |
Summary
Sommersemester 2019...
Description
Wiederholungsfragen zu § 2: Allgemeine Grundrechtsdogmatik Begriff und Theorie der Grundrechte Frage 1: Inwiefern widerspricht sich das Grundgesetz in der ausdrücklichen Benennung von Grundrechten? Formeller Grundrechtsbegriff des GG a) „I. Die Grundrechte“ o Art. 1-19
Art. 1 III GG: „Die nachfolgenden Grundrechte“ nicht alles Grundrechtsbestimmungen vgl. Art. 12a nicht alle Grundrechtsbestimmungen, vgl. Art. 20 IV -> grundrechtsgleiche Rechte b) Art. 93 I Nr. 4a GG: dort bezeichnete Rechte sind Grundrechte o unklar f,r Art. 1-19 o unsauber f,r Art. 38 I 2 GG Materieller Grundrechtsbegriff a) (nur) liberale Grundrechte o Grundrechte sind nur die Rechte des liberalen B,rgertums (C. Schmitt) Arg. Ideengeschichtliche Tradition; WRV b) Menschenrechtlichkeit
c) Menschenrechtspositivierung d) Demokratieskeptischer Grundrechtsbegriff o Grundrechte sind Rechte, die so wichtig sind, dass die Entscheidung ,ber ihre Gewährung nicht der (einfachen) parlamentarischen Mehrheit ,berlassen werden darf. o vgl. Art. 79 GG o historisch bedingtes Grundrechtsverständnis (vordemokratisch) e) Verfassungsrechtlicher GR-Begriff Frage 2: In welchen Zusammenhängen lässt sich die Menschenrechtlichkeit mit dem Grundrechtsbegriff stellen? Menschenrechtlichkeit Grundrechte sind Menschrechte Def. Menschenrechte: (1) universale, (2) fundamentale, (3) abstrakte, (4) moralische geltende und (5) gg,. Positivem Recht prioritäre Rechte Menschenrechtspositivierung (subj.-teleol. = welchen Sinn und Zweck wollte Gesetzgeber mitgeben) Grundrechte sind Rechte, die mit der Absicht oder der Intention in die Verfassung aufgenommen worden sind, Menschenrechte zu positivieren. Frage 3: Wie lautet der verfassungsrechtliche Grundrechtsbegriff? Erläutern Sie die einzelnen Merkmale des Begriffs. Verfassungsrechtlicher GR-Begriff Grundrechte sind (1) abstrakte -> Abwägungsg,ter (2) verfassungsrechtlich positivierte -> in Verfassung niedergschrieben (3) gg,. Niederem Recht prioritäre -> Vorrangregelung (4) als solche justitiable Rechte -> einklagbar Frage 4: Erläutern Sie, inwiefern Grundrechte einerseits inhaltlich, andererseits strukturell offene Normen sind! (F 5 f.) Inhaltliche Offenheit Unterdeterminiertheit (sollen nicht ausbestimmt sein!) der GR-Bestimmungen (Kehrseite der Abstraktheit)
besondere Bedeutung der Grundrechtsinterpretation und der Kompetenz zur Letztinterpretation (Rspr. oder Gesetzgeber oder vollziehende Gewalt?) o insb.: Gefahr politischer Einflussnahme jenseits demokratischer Repräsentation o Tendenz zur „Fberkonstitutionalisierung“ Grenzen der Verfassungsinterpretation? VerfG: judicial self-restraint Strukturelle Offenheit GR können nicht unbegrenzt realisiert werden (jedes GR hat Grenzen mind. durch andere GR) Artikel 101 LVerf: Jedermann hat die Freiheit, innerhalb der Schranken der Gesetze und der guten Sitten alles zu tun, was anderen nicht schadet (Begrenzung). Art. 2 I GG: (…) soweit er nicht die Rechte anderer verletzt (Begrenzung) (…) tentative (keine definitiven) Grundrechtspositionen kollidieren notwendig definitive Grundrechtsposition ist im Kollisionsfall zu ermitteln GR sind Abwägungsg,ter Annahme: keine absoluten („GR geht immer vor“), nur bedingte Vorrangrelationen (wann geht welches GR vor?) Ausnahme: Art. 79 III GG
Träger der (Letzt-)Abwägungskompetenz: BVerfG Frage 5: Welche gesellschaftspolitischen Vorverständnisse spiegeln sich in den Grundrechten des Grundgesetzes? Inwiefern sind diese Vorverständnisse für die Grundrechtsinterpretation von Belang? GR-Theorie: universelle Betrachtung der Grundrechte als Selbstvergewisserungsreservoir der Grundrechtsdogmatik Auswirkungen auf Grundrechtsinterpretation herrschende GR-Interpretation entscheidet ,ber verfassungsrechtlich verfestigte Gesellschaftspolitik liberal-individuelles Verständnis: Schutz der (vorstaatlichen) Freiheit des B,rgers vor dem Staat vgl. Art. 2 II GG Staat als Gefährder sozialstaatliches Verständnis: Ermöglichung der (nachstaatlichen) Freiheit des B,rgers durch den Staat vgl. Art. 3 II 2 GG Staat als Helfer demokratisch-funktionales Verständnis: GR als Demokratiesicherung vgl. Art. 8 GG Staat als Prozess bürgerlicher Willens- und Meinungsbildung ökologisch-kollektives Verständnis: nachhaltige Sicherung der Lebensgrundlagen vgl. Art. 20a GG Staat als Beschützer kollektiver Güter sozialistisches Verständnis: GR dienen Sicherung der Produktionsbedingungen; größeres Ziel des Gemeinwohls vgl. Art. 15 GG Staat als >bergangsphänomen zur klassenlosen Gemeinschaft Frage 6: Welche vier verfassungstheoretischen Vorverständnisse lassen sich, mit dem Blick auf den Weimarer Methodenstreit, für die Grundrechtsinterpretation heute unterscheiden? Welche vier Grundrechtsverständnisse resultieren daraus? (F 9) Hans Kelsen: Normativismus o Verfassung = Rechtsordnung = Gesetz GR als rein rechtliche Entität Carl Schmitt: Dezisionismus o Verfassung = Substanz (Identität) der Organisation; fakt. Macht M Gesetz GR als der staatlichen Dezision unterworfene Programmsätze Rudolf Smend: Integrationismus o Verfassung = Abstraktion gesellschaftlicher Wirklichkeit = beständiger Integrationsprozess GR als Identitätskern (obj.) gesellschaftlicher Werte Hermann Heller: Soziologismus o Staat = organisierte Entscheidungs- und Wirkungseinheit = soziale Größe GR als Wiedergabe kultureller Fberzeugungen Frage 7: Erläutern Sie die Unterscheidung zwischen Innen- und Außentheorie anhand der Begriffe des tentativen, des präformierten und des definitiven Schutzbereichs! Worin liegt die Relevanz dieser Unterscheidung für die Grundrechtsanwendung? (F 10-12) a) Innentheorie o eher privatrechtliches Verständnis von Grundrechten als Anspr,chen (gegen den Staat) o Immanenztheorie: GR hat (wie jedes subjektive Recht) von vornherein ihm innewohnende (immanente) Schranken Bsp.: Art. 8 I GG sch,tzt nur Versammlungen, die der öffentlichen Meinungsbildung dienen (str.) -> immanente Beschränkung o weitergehend: kein tentativer (unbestimmt, nur scheinbarer) Schutzbereich sondern definitiver (präformierter) Schutzbereich ist zu erkennen (m,ssen nur finden, was das Recht ist) o Präformationstheorie Folge: GR-Positionen werden nicht beschränkt, sondern stets nur verletzt oder nicht verletzt hM, v.a. Menschenw,rde, Art. 1 I GG probl.: Begriff der grundrechtsimmanenten Schranken b) Außentheorie: Schutzbereich-Eingriff-Modell o Schutzbereich: prima facie-Schutz als GR-Position (tentativer Schutz) o Eingriff: staatliche Maßnahme als Eingriff ist Schutzbereichsber,hrung o Rechtfertigung: verfassungsrechtliche Schranken der GR-Position umfassen Eingriff (nicht) kein Grundrecht ist schrankenlos gewährleistet o Schranken-Schranken: verfassungsrechtliche Grenzen der Beschränkung (z.B. Verhältnismäßigkeit) o definitive Rechtsposition: GR-Verletzung gerichtlich durchsetzbar gegen staatliche Gewalt vgl. Art. 93 I Nr. 4a GG c) konzeptioneller Unterschied? o beide Sichtweisen in BVerfG-Rechtsprechung in beiden Fällen definitive Rechtsposition entscheidend Relevanz der Unterscheidung str. Arg. 1: Entziehung eines Rechts auf Nachpr,fung einer GR-Verletzung durch Innentheorie aber: Art. 19 IV GG Recht auf gerichtliche Pr,fung einer Verletzung in (definitiver) GR-Position Arg. 2: strukturelle Offenheit f,r differenzierende GR-Lösungen durch Außentheorie Einzelfalladäquanz aber: Art. 3 I GG; Differenzierung in GR-Schutz nicht zulässig
Frage 8: Erläutern Sie die normtheoretische Unterscheidung von Regeln und Prinzipien. Geben Sie jeweils ein Beispiel! Zu welcher Kategorie zählen Grundrechte? (1) Regeln: Normen, die stets nur entweder erf,llt oder nicht erf,llt werden können. z.B. Rechtsfahrgebot definitives Sollen (2) Prinzipien: Normen, die gebieten, dass etwas in einem möglichst hohen Maße realisiert wird Optimierungsgebote Z.B. Allgemeine Handlungsfreiheit prima-facie Sollen GR als abwägungsfähige und abwägungsbed,rftige G,ter -> GR als Prinzipien Frage 9: Beschreiben Sie einen Regelkonflikt anhand eines Beispiels und erläutern Sie die Mechanismen zur Auflösung derartiger Konflikte! Bsp.: BverfGE 1, 283/292 ff. Regel 1: Landesrecht verbietet Sffnung von Verkaufsstellen ab Mittwoch, 13.00 Uhr Regel 2: Bundesrecht erlaubt Sffnung an Wochentagen bis 19.00 Uhr nur entweder/oder möglich Lösung: Art. 31 GG, „Bundesrecht bricht Landesrecht“. landesrechtliche Regel ist ung,ltig Frage 10: Beschreiben Sie eine Prinzipienkollision anhand eines Beispiels und erläutern Sie die Mechanismen zur Auflösung derartiger Konflikte! Erklären Sie, inwiefern die Auflösung einer Prinzipienkollision zu einer Regel führt! Prinzipienkollision f,hrt zu Abwägung (im konkreten Fall) Bsp.: BverfGE Lebach Sachverhalt: Beschwerdef,hrer war an einer schweren Straftat, dem sog. Soldatenmord von Lebach, beteiligt, die Gegenstand eines Schwurgerichtsverfahrens war. Die beiden Haupttäter waren untereinander und mit dem Beschwerdef,hrer befreundet, wobei die Beziehungen zum Teil eine homosexuelle Komponente hatten. Die drei jungen Männer strebten die Gr,ndung einer Lebensgemeinschaft außerhalb der von ihnen abgelehnten Gesellschaft an. Sie planten einen Fberfall auf ein Munitionsdepot der Bundeswehr, um Waffen zu erbeuten, mit deren Hilfe sie sich durch weitere Straftaten die Mittel zur Verwirklichung des erträumten Lebens auf einer Hochseeyacht in der S,dsee verschaffen wollten. Im Januar 1969 f,hrten die beiden Haupttäter den Fberfall aus; sie töteten hierbei vier schlafende Soldaten der Wachmannschaft, verletzten einen weiteren schwer und entwendeten Waffen und Munition. Später versuchten sie, unter Hinweis auf diese Tat einen Finanzmakler zu erpressen. Der Beschwerdef,hrer habe bei den Planungen der Freundesgruppe immer wieder erklärt, er sei zur Tatausf,hrung nicht imstande; daher hatte er bei dem Fberfall nicht mitgewirkt.“ zum Entscheidungszeitpunkt Beschwerdef,hrer kurz vor Haftentlassung ZDF plant Ausstrahlung des Fernsehspiels „Der Soldatenmord von Lebach“ „Nach dem vom Oberlandesgericht festgestellten – unstreitigen – Sachverhalt soll das Spiel im Programm des ZDF voraussichtlich an einem Freitagabend als zweiteilige, von Kurznachrichten unterbrochene Sendung in einer Gesamtdauer von 2 Stunden und 40 Minuten ausgestrahlt werden. Der erste Teil des Spiels stellt die Beziehungen innerhalb der Freundesgruppe, die Planung des Fberfalls und seine Ausf,hrung dar. Der zweite Teil behandelt vor allem die Fahndung und Ermittlung der Täter, ferner den Erpressungsversuch. Der Beschwerdef,hrer wird ebenso wie die Haupttäter eingangs im Bilde vorgef,hrt, sodann von einem Schauspieler dargestellt. Sein Name wird während des ganzen Spiels immer wieder genannt.“ Lösung: nur durch Abwägung der kollidierenden G,ter möglich; praktische Konkordanz Kollidierende Verfassungsg,ter Prinzip 1: Art. 5 I S.2 GG vs P2: Art. 2 I i.V.m. Art. 1 I GG Kollisionslösungen Absolute oder relative (“bedingte”) Vorrangrelation? Absolut: P1PP2 oder P2PP1 welches Prinzip ist wichtiger? Welches wird präferiert? Relativ: (P1PP2)C oder (P2PP1)C P: precedes („Präferenzoperator“) C: conditions Pn: Prinzip N Hier (wie fast immer): keine absolute Vorrangrelation zwischen Verfassungsg,tern Bedingte Vorrangrelation -> beide maximale Geltung Ergebnis des BVerfG (Ls. 3) „F,r die aktuelle Berichterstattung ,ber schwere Straftaten verdient das Informationsinteresse der Sffentlichkeit im allgemeinen den Vorrang vor dem Persönlichkeitsschutz des Straftäters. Jedoch ist neben der R,cksicht auf den unantastbaren innersten Lebensbereich der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten; danach ist eine Namensnennung, Abbildung oder sonstige Identifikation des Täters nicht immer zulässig. Der verfassungsrechtliche Schutz der Persönlichkeit läßt es jedoch nicht zu, daß das Fernsehen sich ,ber die aktuelle Berichterstattung hinaus etwa in Form eines Dokumentarspiels zeitlich unbeschränkt mit der Person eines Straftäters und seiner Privatsphäre befasst. Eine spätere Berichterstattung ist jedenfalls unzulässig, wenn sie geeignet ist, gegen,ber der aktuellen Information eine erhebliche neue oder zusätzliche Beeinträchtigung des Täters zu bewirken, insbesondere seine Wiedereingliederung in die Gesellschaft (Resozialisierung) zu gefährden. Eine Gefährdung der Resozialisierung ist regelmäßig anzunehmen, wenn eine den Täter identifizierende Sendung ,ber eine schwere Straftat nach seiner Entlassung oder in zeitlicher Nähe zu der bevorstehenden Entlassung ausgestrahlt wird.“
(P2PP1)C Ergebnis hängt vom Zufall ab -> bei Angemessenheit pr,fen Frage 11: Diskutieren Sie die Kritik an der Prinzipientheorie, insb. den Irrationalitätseinwand, den Antirechtseinwand, den Entpolitisierungseinwand und den Identitätseinwand! (F 20-22) (1) Irrationalitätseinwand These: Abwägung ist nicht rational Arg.: Grundrechte/Standpunkte/Wertungen sind inkommensurabel aber: mehr oder weniger intensive Beeinträchtigung ist rational feststellbar (Komparationsrationalität) (2) Antirechtseinwand These: Abwägungen entziehen sich abstrakt-genereller Festlegung Arg.: Abwägungen sind stets auf konkreten Fall bezogen und somit strukturell individuell; Recht soll aber generell bzw. universell sein aber: Recht gibt Abwägungen vor Ziel kann nur sein: Abwägungen begrenzen (3) Entpolitisierungseinwand These: Verfassung als Allesbestimmer -> „Justizstaat“; „Verfassung als Weltenei“ Arg.: VerfG als letzte Abwägungsinstanz Richtigkeit stets grundrechtliche Frage letztlich kein verfassungsfester politischer Spielraum des Gesetzgebers aber: Anerkennung von Spielräumen insb. „formelles Prinzip“ des Entscheidungsspielraums des Gesetzgebers gest,tzt auf Demokratieprinzip Konstruktionsgrundsatz des Staates des GG unzutreffend „lediglich aufgrund epistemischer Schwierigkeiten“ (4) Identitätseinwand These: Prinzipien sind Regeln -> kein normstruktureller Unterschied Arg.: Optimierungsgebote sind definitive Gebote -> Es ist (definitiv) geboten, den Optimierungs-gegenstand zu optimieren (Op). aber: Prinzipien bilden den Sonderfall des Optimierungsgebots -> Es ist (definitiv) geboten, zu optimieren: OOptp. Unterschied: Ausnahmegr,nde sind Anwendungsbedingungen -> Prinzipien sind non-defeasible Wiederholungsfragen zu § 2: Allgemeine Grundrechtsdogmatik Funktionen der Grundrechte Frage 1: Benennen und erläutern Sie die vier statJs, in denen der Bürger zum Staat nach der klassischen Einteilung Georg Jellineks stehen kann! Geben Sie jeweils Beispiele aus dem Grundgesetz! Status: Zustand des Einzelnen gegen,ber dem Staat, in verschiedenen Grundrechten ausgeformt und gesichert o status negativus: Freiheit vom Staat – Grundrechte als Abwehrrechte (z.B. Art. 4 GG) o status positivus: Freiheit nicht ohne den Staat – Grundrechte als Anspruchs-, Schutz-, Teilhabe-, Leistungs- und Verfahrensrechte (z.B. Art. 6 Abs. 4 GG) Derivative Rechte (auf Inanspruchnahme bestehender staatlicher Vorkehrungen gerichtet) Originäre Rechte (auf Schaffung neuer staatlicher Vorkehrungen gerichtet) o status activus: Freiheit im und fr den Staat – Grundrechte als staatsb,rgerliche Rechte (z.B. Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG) o status passivus: Staatenlosigkeit – Keine Beziehung zwischen B,rger und Staat! -> GG (–) Frage 2: Erläutern Sie den Begriff der Einrichtungsgarantien und die Unterscheidung in institutionelle und Institutsgarantien! Geben Sie jeweils drei Beispiele! Diskutieren Sie, inwiefern diese Lehre unter dem Grundgesetz noch relevant oder verfassungsrechtlich überholt ist! - Einrichtungsgarantien: keine subjektiven Rechte des Einzelnen, sondern vielmehr Garantien der Grundrechte f,r objektive Einrichtungen -> dabei wird in sog. Institutsgarantien und sog. institutionelle Garantien unterschieden - Garantien haben das Ziel rechtliche Errungenschaften (f,r die es kein reales Pendant gibt; z.B. die Ehe -> privatrechtliches Institut, dass vom Staat „eingef,hrt“ wurde) vor der gesetzgeberischen Disposition zu sch,tzen - Institutsgarantien: garantieren privatrechtliche Einrichtungen z.B: Ehe, Art. 6 I GG; Eigentum, Erbe, Art. 14 I GG ; Privatschule, Art. 7 IV 1 GG - institutionellen Garantien: garantieren öffentlich-rechtliche Einrichtungen z.B: Berufsbeamtentum Art. 33 IV, V GG; Religionsunterricht an öffentlichen Schulen Art.7 II S.1 GG; Selbstverwaltung der Universitäten Art. 5 III GG - Verfassungsrechtliche Fberholung: flankierender subj.-rechtl. GR-Schutz heute str. aber: ohnehin ubiquitäre GR Bindung ,ber Art. 1 III, 2 I GG o Bedeutung der Einrichtungsgarantien (nur) noch als Interpretations- bzw. Abwägungsgrenze o Ausgestaltungsfunktion: einige Grundrechtsgegenstände sind rechtsordnungsabhängig o kennzeichnend: kein lebensweltliches Pendant z.B. Eigentum, Art. 14 GG existentielles Erfordernis der Ausgestaltung durch Gesetzgeber o vgl. Art. 14 I 2 GG: Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.
aber: Grundrecht des Einzelnen setzt Rechtsinstitut „Eigentum“ voraus; es wäre nicht wirksam gewährleistet, wenn der Gesetzgeber an die Stelle des Privateigentums etwas setzen könnte, was den Namen „Eigentum“ nicht mehr verdient. (untere) Grenze der Ausgestaltung: Institutsgarantie Problem: Bestimmung der verfassungsrechtlichen Grenzen der Ausgestaltung Vielmehr m,ssen die einzelnen Regelungen des b,rgerlichen Rechts an Art. 6 Abs. 1 GG als vorrangiger, selbst die Grundprinzipien enthaltender Leitnorm gemessen werden. Gewiss hat der Gesetzgeber hierbei einen erheblichen Gestaltungsraum. Dennoch können etwa zu strenge oder zu geringe Sach- oder Formvoraussetzungen der Eheschließung mit der Freiheit der Eheschließung oder anderen sich aus der Verfassung selbst ergebenden Strukturprinzipien der Ehe unvereinbar sein. Problem: Bestimmung der Strukturprinzipien - nach Form (statisch) - oder Funktion (dynamisch)? Bsp.: Sffnung des Ehebegriffs gem. § 1353 I BGB Eheform: anderer Ehebegriff Ehefunktion: gleicher Ehebegriff Frage 3: Erläutern Sie den Begriff der negativen Kompetenznorm. Inwiefern sind Grundrechte als solche Normen zu bezeichnen? Grundrechte haben die objektiv-rechtliche Funktion den Handlungs- und Entscheidungsspielraum des Staates zu begrenzen. Die Staatsgewalt kann also im Rahmen des von den Grundrechten zulässigen Gebrauchs ausge,bt werden (Art 1 III GG !!!). Trotzdem sind die Grundrechte aus der B,rgerperspektive als subjektive Rechte des Einzelnen zu verstehen. Sie nehmen dem Staat quasi Handlungsspielraum und ,berlassen diesen dem B,rger (objektiv gesehen, d.h. sie nehmen dem Staat den Spielraum unabhängig davon ob der B,rger ihn geltend macht) Negative Kompetenznormen: Begrenzung staatlicher Kompetenz im Verhältnis zu B,rgern -> staatliche Pflicht zur Beachtung der Grundrechte bei allen Handlungen (Art. 1 III GG) Bsp.: pos. Kompetenznorm Art. 73 I Nr. 7 GG; neg. Kompetenznorm Art. 10 II GG, Art. 2 I GG als „Meganegativkompetenz“ Die Grundrechte begrenzen die staatliche Macht, d.h. der Staat darf nicht gegen die Grundrechte verstoßen Frage 4: Inwiefern entfalten Grundrechte Wirkung auch im Zivilrecht? Diskutieren Sie die Konzepte der mittelbaren und der unmittelbaren Drittwirkung! Problem: Grundrechte sind grundsätzlich als Abwehrrechte zwischen B,rger und Staat zu verstehen. Sie binden gem. Art 1 III GG den Staat. Entfalten sie auch Wirkung im Privatrecht? - Lsg. 1: unmittelbare Drittwirkung: eher Mindermeinung, in Einzelfällen manchmal bejaht, z. B. Art 9 III GG; Dagegen spricht vor allem, dass der Wortlaut des Art 1 III GG lediglich den Staat bindet. - Lsg. 2: mittelbare Drittwirkung: Danach haben die Zivilgerichte bei der Anwendung und Auslegung allgemeiner, wertungsausf,llungsbed,rftiger Begriffe des Zivilrechts die Grundrechte zu beachten, da diese nicht nur Abwehrrechte darstellen, sondern auch Ausdruck einer objektiven Wertordnung sind. (Ausstrahlungswirkung!) - Lsg. 3: Scheinproblem: Es handele sich bei der Drittwirkung um ein Scheinproblem, denn der B,rger berufe sich im Dreiecksverhältnis B,rger-Richter-B,rger gegen,ber dem Richter als Teil der staatlichen Gewalt auf die Grundrechte, und nicht gegen,ber der anderen Prozesspartei. Der Richter jedoch sei nach Art. 1 III GG als Teil der Rechtsprechung stets grundrechtsgebunden. Frage 5: Was ist unter ausgestaltungsbedürftigen Grundrechten zu verstehen? Welche Grenzen setzt die Verfassung dieser Ausgestaltung strukturell? G...
Similar Free PDFs

Zusammenfassung Grundrechte alles
- 27 Pages

Grundrechte Zusammenfassung
- 23 Pages

Grundrechte Zusammenfassung
- 16 Pages

Lernzettel Grundrechte
- 17 Pages

Grundrechte Skript
- 112 Pages

Transport - alles
- 23 Pages

Übersicht Grundrechte-Einteilung
- 1 Pages

Funktionen der Grundrechte, Uhle
- 3 Pages

Samenvatting - college Alles, compleet
- 167 Pages

Pijnmanagement - Samenvatting alles
- 107 Pages
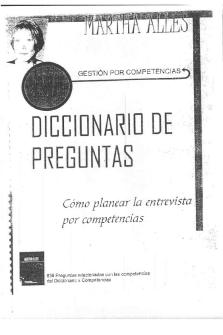
Diccionario de Preguntas Alles
- 199 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu




