Wirtschaftsprivatrecht I PDF

| Title | Wirtschaftsprivatrecht I |
|---|---|
| Course | Wirtschaftsprivatrecht I |
| Institution | Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin |
| Pages | 18 |
| File Size | 225.4 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 525 |
| Total Views | 852 |
Summary
1. Die 3 Sachgebiete des Rechts und worin sie sich unterscheiden Zivilrecht: Privat gegen Privat oder Un gegen kann auch ohne Gericht geeinigt werden, ansonsten vor Zivilgericht, Verlierer Kosten, wichtigste Quelle ist BGB Nebengesetze, kein Amtsermittlungsgrundsatz (Parteien alles selbst darlegen u...
Description
1. Die 3 Sachgebiete des Rechts und worin sie sich unterscheiden Zivilrecht: Privat gegen Privat oder Un gegen Un; kann auch ohne Gericht geeinigt werden, ansonsten vor Zivilgericht, Verlierer trägt Kosten, wichtigste Quelle ist BGB + Nebengesetze, kein Amtsermittlungsgrundsatz (Parteien müssen alles selbst darlegen und beweisen, ohne Kläger kein Richter) Strafrecht: Staat gegen Bürger bei strafrechtlichen Verstößen(Staatsanwaltschaft & Polizei), mit Amtsermittlungsgrundsatz, Rechtsverfolgung/-aufklärung ist Verletzten weitgehend entzogen (Machtmonopol des Staates), vor Strafgericht Verwaltungsrecht/ öffentliches Recht: Staat nimmt Sonderstellung ein, vor Verwaltungsgericht, wird unterschieden in
Völkerrecht (regelt Verhältnis von Staaten untereinander)
Staatsrecht (regelt Verhältnis der Staatsorgane zueinander, enthält Grundlage Staatsorganisation)
Verfassungsrecht (regelt Verhältnis zw. Bürger und Staat, sichert Grundrechte Art. 1-19)
Verwaltungsrecht (regelt Verhältnis zw. Bürger und Staat im Einzelnen)
Allg: entweder Zivil oder öffentlich, Strafrecht kann parallel laufen 2. Was versteht man unter Privatautonomie? „Jeder kann seine Lebensverhältnisse im Rahmen der Rechtsordnung eigenverantwortlich regeln, insbesondere frei darüber entscheiden, ob, mit wem und mit welchem Inhalt er Verträge schließen will.“ -
Es herrscht kein Über-/Unterordnungsverhältnis sondern Gleichordnung und Selbstbestimmung zwischen Parteien
-
Freiheit des Eigentums, Vereinigungsfreiheit, Abschlussfreiheit, Eigenentscheidung über Vertragsinhalt
Vertragsfreiheit,
wird unterschieden in: dispositives Recht: Parteien können abweichende Vereinbarungen treffen
von
gesetzlichen
Regelungen
zwingendes Recht: eine Abweichung von den gesetzlichen Vorgaben durch Vertrag ist unzulässig und unwirksam
3. Was ist eine Willenserklärung (WE) und was sind die Voraussetzungen für die Wirksamkeit einer WE?
Wichtigstes Mittel zur privatautonomen Gestaltung der Rechtslage Eine WE ist eine Willensäußerung, die auf Herbeiführung einer Rechtfolge gerichtet ist.
Voraussetzungen:
Objektiver Tatbestand (Äußerung mit Schluss auf Rechtsbindungwillen)
Subjektiver Tatbestand Erklärungsbewusstsein)
(ausreichendes
Handlungs-
und
4. Wie kommt ein Zivilrechtlicher Vertrag zustande? Zwei müssen empfangsbedürftige WE abgeben, §145 ff. Angebot (muss so formuliert sein, dass Annehmer nur mit Ja antworten kann, Annahme
„Essentialia negotii“ muss enthalten sein (Kaufgegenstand, Kaufpreis, Vetragsparteien) §433
Konsens muss entstehen
Invitatio ad offerendum (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots) muss unterschieden werden von dem Antrag auf Abschluss eines Vertrags (Angebot)
5. Wirksamkeit von Verträgen
Verträge Geschäftsunfähige Menschen unter 7 Jahren oder Geisteskranke, Verträge sind nichtig, dürfen weder WE abgeben noch annehmen, durch gesetzlichen Vertreter (z.B. Eltern) §104
Verträge Minderjähriger 7 -18 Jahre, beschränkt geschäftsfähig, §106 ff
-
Teilgeschäftsfähigkeit (mit Erlaubnis der Eltern Arbeitsverhältnis)
-
rechtlich vorteilhaftes Geschäft (Geschäfte die keine rechtlichen Nachteile für den Minderjährigen haben)
-
Taschengeldparagraph (Vertrag ist wirksam, wenn Minderjährigem Mittel zur freien Verfügung überlassen wurden und er mit diesen vertragsmäßige Leistungen bewirkt hat)
-
Genehmigung (Vertrag ohne Einwilligung ist schwebend unwirksam bis nachträgliche Zustimmung durch Vertreter entsteht, Frist 2 Wochen) §184
Formmängel Wird gesetzlich vorgeschriebene Form missachtet, ist das Geschäft nichtig Formerfordernisse (Klarstellungs-/Beweisfunktion):
-
Notarielle Beurkundung (Notar erstellt Vertragsurkunde)
-
Öffentliche Beglaubigung (bezeugt Echtheit der Unterschriften)
-
Gesetzliche Schriftform (Schriftstück muss eigenhändig unterzeichnet werden, darf nicht per Fax übermittelt werden)
-
Elektronische Form (mit elekt. Signatur nach dem Signaturgesetz)
-
Textform (keine eigenhändige Unterschrift erforderlich, auch Fax/Email) Bei freiwilliger Erbringung der formungültig versprochenen Leistung mit der Erfüllung wird der Formmangel geheilt, Vertrag ist gültig
Verstoß gegen ein Verbotsgesetz §134 Rechtsgeschäft kommt wegen besonderer Umstände oder Inhalt nicht zustande, z.B. Verkauf von Diebesgut,
Sittenwidrigkeit und Wucher §138 Geschäft ist sittenwidrig wenn es mit grundlegenden rechtlichen Wertungen unvereinbar ist, z.B. Verabredung zum Verbrechen, Leihmuttervertrag Sonderfall Wucher: Missverhältnis von Leistung u. Gegenleistung
Anfechtung §142 Die Anfechtung ist ein Gestaltungsrecht, mit dem man sich von vertraglichen Verpflichtungen befreien kann (wie z. B. Rücktritt, Widerruf, Kündigung)
-
Inhaltsirrtum (Weiß was er sagt, aber nicht was er meint)
-
Erklärungsirrtum (Er weiß nicht was er sagt, Verschreiben/Versprechen)
-
Eigenschaftsirrtum (irrt sich über relevante wertbildende Merkmale)
-
Arglistige Täuschung/Drohung
Aufschiebende / auflösende Bedingung Bei der aufschiebenden Bedingung wird der Vertrag ohne den Bedingungseintritt nicht wirksam. Bei der auflösenden Bedingung wird das zunächst wirksame Rechtsgeschäft mit Bedingungseintritt rückwirkend unwirksam.
6. Anfechtungsschema 1) Zulässigkeit der Anfechtung 2) Anfechtungsgrund (einfache Irrtümer §119, arglistige Irrtümer §123) 3) Anfechtungserklärung §143 4) Anfechtungsfrist §121 unverzüglich, §124 „ein Jahr“ 5) Rechtsfolge §142 7. Voraussetzungen der Stellvertretung §164
Zulässigkeit der Stellvertretung Gilt für alle WE außer höchstpersönliche Rechtsgeschäfte
Eigene WE des Vertreters Vertreter muss WE abgeben, es darf keine Hilfsperson als Bote fungieren der eine fremde WE überbringt
In fremden Namen Vertreter muss ausdrücklich im Namen des Vertretenen handeln oder dies muss sich zumindest aus den Umständen ergeben; ist Fremdwirkung nicht erkennbar, schließt der Vertreter den Vertrag für sich selbst ab
Mit Vertretungsmacht §167 ff.
-
Vollmacht (Außenvollmacht für Geschäftsgegner, erlischt bei Endung Rechtsverhältnis oder zeitlicher Befristung)
-
Gesetzliche oder organschaftliche Vertretungsmacht (Eltern für Kinder, Geschäftsführer für GmbH)
-
Anscheinsvollmacht (Verträge sind wirksam trotz Unwissenheit des Vertretenen, da er sich hätte informieren können)
-
Duldungsvollmacht (Vertretene lässt es wissentlich geschehen, dass ein anderer für ihn ohne Vertretungsmacht als Vertreter auftritt
8. Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (Schaufensterbeispiel)
Auslage von Ware im Schaufester oder Regal soll Rechtsgeschäft vorbereiten, man fordert Kunden auf ein Vertragsangebot zu machen (invitatio ad offerendum) 9. Voraussetzung und Rechtsfolgen des Verzugsschadensersatz Der Schuldner gerät in Verzug, wenn er die ihm mögliche Leistung trotz Fälligkeit und Mahnung nicht erbringt (§ 286 Abs. 1 S. 1 BGB). Voraussetzungen: (wirksames
Schuldverhältnis,
fälliger, durchsetzbarer Anspruch muss fällig sein)
Mahnung bzw. Entbehrlichkeit der Mahnung (Eine Mahnung ist jede an den Schuldner gerichtete Aufforderung, die geschuldete Leistung zu erbringen)
Nichtleistung (Verzugsschadensersatzanspruch setzt neben Verzug auch Nichtleistung voraus, Verzug endet mit Leistungserbringung)
Vertretenmüssen des Schuldners (keine Voraussetzung für den Verzugsschadensersatz, sondern Fehlen ist ein Einwendungstatbestand)
Anspruch
Schuldner muss beweisen, dass er nicht für den Verzug verantwortlich ist, sondern sein Vertreter Rechtsfolgen:
Der Gläubiger kann vom Schuldner Ersatz für entgangenen Gewinn verlangen
Gläubiger kann durch den Verzug verursachte Aufwendungen und die Kosten der Rechtsverfolgung ersetzt verlangen (er hat insgesamt den so genannten Verzögerungsschaden zu ersetzen)
Gläubiger kann vom Schuldner Verzugszinsen bei Geldschulden verlangen (§ 288 BGB)
10. Sachmangel einer Kaufsache prüfen Der Kaufvertrag ist ein gegenseitiger verpflichtender Vertrag. (§433 BGB)
Prüfungszeitpunkt (§446, 447 BGB) Beschädigungen oder Zerstörungen der Sache trägt bis zur Übergabe allein der Verkäufer, wenn Verkäufer die Sache an Spediteur übergibt, muss der Käufer den Zeitpunkt des Gefahrenübergangs beweisen Sachmangel (§434 BGB):
Stufe 1: Ware mangelhaft bei Abweichung von vertraglich vereinbarter Beschaffenheit
Stufe 2: Ware mangelhaft bei vorausgesetzten Verwendungszweck
Stufe 3: Abweichungen von der objektiven Sollbeschaffenheit
Nichteignung
zum
vertraglich
11. Welche Mängelgewehrleistungsrechte hat man?
Nacherfüllung: §437 Nr. 1 i.V.m. §439
-
Käufer nach seiner Wahl Mängelbeseitigung/Reparatur Ersatzlieferung einer mangelfreien Sache verlangen.
-
Verkäufer hat die Option, eine oder beide Formen der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden sind
Rücktritt vom Vertrag §437 Nr. 2
-
Rücktritt erst wenn Frist zur Nacherfüllung abgelaufen ist
-
Käufer kann bei behebbaren Mängeln ohne Fristsetzung zurücktreten, wenn Schuldner beide Arten der Nacherfüllung verweigert, die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder für den Käufer unzumutbar ist
-
Bei unbehebbaren ist Rücktritt immer sofort möglich
Minderung §437 Nr. 2 i.V.m. §441
-
Kaufpreisanspruch des Verkäufers erlischt in Höhe des Minderungsbetrages
-
Hat Käufer schon den gesamten Kaufpreis gezahlt, ergibt sich Erstattungsanspruch
Schadensersatz und Aufwendungsersatz §437 Nr.3 i.V.m. §280,284
-
setzen Verantwortlichkeit des Käufers voraus (Verschulden)
-
Schadensersatz neben der Leistung erhält der Käufer sofort und ohne Fristsetzung
Beim Schadensersatz statt der Leistung ist wie beim Rücktritt zu differenzieren: - Bei behebbaren Mängeln besteht ein Anspruch erst nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist. Bei nachträglich oder anfänglich unbehebbaren Mängeln besteht der sofort. 12. Wie wird eine bewegliche Sache übereignet?
oder
Die Übereignung beweglicher Sachen vollzieht sich nach folgendem Prüfungsschema:
Wirksame Einigung im Sinne des § 929 S. 1 BGB;
Übergabe bzw. Entbehrlichkeit der Übergabe bzw. Ersatz der Übergabe
Einigsein zum Zeitpunkt der Übergabe (wird nur geprüft, wenn Einigung und Übergabe zeitlich auseinanderfallen)
13. Wo ist der Herausgabeanspruch geregelt? Gemäß § 985 BGB hat der Eigentümer gegen den Besitzer einer beweglichen oder unbeweglichen Sache einen Herausgabeanspruch. Der Besitzer kann die Herausgabe der Sache allerdings verweigern, wenn er ein Recht zum Besitz hat (§ 986 BGB). Ein Recht zum Besitz kann sich aus Schuldverträgen ergeben. 14. Wie wird ein Grundstück übereignet? Die Übereignung von Grundstücken vollzieht sich nach folgendem Schema:
Einigung
Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuch;
Einigkeit zur Zeit der Eintragung
§873, 925
Fall 1: HWR-Student Raphael wohnt in Berlin zur Miete in einer Ein-Zimmer-Wohnung. In dem Mietvertrag ist für Raphael eine Kündigungsmöglichkeit jeweils zum Monatsende mit einer Kündigungsfrist von einem Monat vorgesehen. In der Vorlesung hat er die Mitstudentin Svenja kennen gelernt und nach einigen Monaten beschließen die beiden, sich gemeinsam eine größere Wohnung zu nehmen. Raphael schreibt daher am 23.5. seinem Vermieter Volkmann einen Brief und kündigt die Wohnung zum 30.6. Wegen der starken Belastung im Studium und durch die Wohnungssuche kommt er erst dazu, den Brief am 31.5. um 22 Uhr bei dem Vermieter in den Briefkasten zu werfen. Dieser findet den Brief am Morgen des 1.6., als er seine Zeitung aus dem Briefkasten holt. Volkmann ist mit der Kündigung nicht einverstanden. Kann V von R die Miete für Juli fordern? Abwandlung 1: Volkmann hat noch am späten Abend des 31.5. in seinen Briefkasten geschaut und den Brief gefunden und gelesen. Wie ist die Lage nun zu bewerten? Abwandlung 2: Raphael wirft den Brief noch am 23.5. in einen Briefkasten der Deutschen Post AG. Allerdings hat er versehentlich seinen Brief nicht ausreichend frankiert, denn statt einer 58Cent-Briefmarke hat er lediglich eine 45-Cent-Briefmarke aufgeklebt. Der Postbote klingelt bei Volkmann und fragt ihn, ob er den Brief trotzdem annehmen möchte, dann müsse er aber Nachporto bezahlen. Volkmann erkennt den Absender und vermutet schon, dass es sich um eine Kündigung handeln könnte. Er weigert sich, das Nachporto zu bezahlen. Der Postbote nimmt den Brief wieder mit. Erst am 31.5. erhält Raphael den Brief mit dem Vermerk zurück „ Annahme wegen nicht ausreichender Frankierung verweigert“. Darauf schickt Raphael den Brief am 2.6. mit ausreichender Frankierung erneut an Volkmann, dieser erhält ihn am 3.6. Muss Raphael für den Monat Juli Miete zahlen?
Lösung Fall 1: Anspruch des V gegen R auf Zahlung der Miete für den Monat Juli aus § 535 Abs. 2 BGB 1. Wirksamer Mietvertrag, § 535 BGB 2. Vorliegen einer wirksamer Kündigung zum 30.06., vgl. § 542 BGB a) Abgabe der Erklärung - Brief vom 23.05. (Einwurf 31.05., 22.00 Uhr) b) Fristgerechter Zugang (§ 130 BGB) • Zugegangen ist der Brief (die WE), wenn er so in den Machtbereich des Empfängers gelangt ist, dass dieser unter normalen Verhältnissen die Möglichkeit hat, vom Inhalt Kenntnis zu nehmen. Maßgeblich sind die "gewöhnlichen" Verhältnisse. Einwurf um 22.00 Uhr in Privatbriefkasten erfolgt außerhalb des Zeitraums, in dem "üblicherweise" mit Leerung und Kenntnisnahme vom In-halt zu rechnen ist (Rsp.: bis ca. 18.00 Uhr). • Möglichkeit der Kenntnisnahme? Hier: erst zu „normalen“ Leerungszeiten des Briefkastens, also am 01.06. 3. Ergebnis Die Kündigung ist nicht rechtzeitig zugegangen wirkt also frühestens zum 31.07. Abwandlung 1: Nimmt der Empfänger tatsächlich schon früher als nach der Verkehrsanschauung zu erwarten gewesen wäre von der Willenserklärung Kenntnis, so ist allein dieser Zeitpunkt für den Zugang maßgeblich. Abwandlung 2: 1. Abgabe der Erklärung - Brief vom 23.05. (unterfrankierter Brief) 2. Fristgerechter Zugang • hier: berechtigte Zugangsverweigerung: Unzureichende Frankierung geht zu Las-ten des Erklärenden, der Empfänger muss die Erklärung nicht annehmen, auch wenn er ahnt, was der Brief enthält. Bei einer unberechtigten Verweigerung geht die Erklärung dagegen zum Zeitpunkt des Angebots der Aushändigung zu. • damit keine Zugangsfiktion, Zugang erst am 03.06.
Fall 2: Valentin Volz (V) ist Eigentümer der zweijährigen Rauhaardackelhündin Rosi, die vier sehr niedliche Mischlingswelpen zur Welt bringt. Auf Grund des regen Interesses in der Nachbarschaft entschließt sich V, die Welpen im Alter von zehn Wochen für je 50,00 EUR zu verkaufen. Da er gerade seinen alten PKW unter Zuhilfenahme eines im Schreibwarenladen gekauften Formularvertrages veräußert hat, setzt er nach dessen Muster vier "Hundekaufverträge" auf. Sie enthalten unter anderem die Klausel "Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung." Auf dieser Basis kauft auch Konrad Kaiser (K) einen der Welpen. Vier Wochen nach dem Kauf stellt K bei dem Hund, der inzwischen Waldemar heißt, eine Wurmerkrankung fest. Er erkundigt sich bei den anderen Nachbarn, die Welpen aus dem Wurf gekauft haben, und erfährt, dass auch die anderen Tiere Würmer haben. Daraufhin begibt sich K mit Waldemar zu V und fordert ihn auf, das Tier auf seine Kosten gegen den Wurmbefall behandeln zu lassen. V weigert sich unter Hinweis auf die Vertragsklausel. Besteht der von K geltend gemachte Anspruch?
Lösung - Ausgangsfall: I. Nacherfüllungsanspruch gemäß §§ 437 Nr. 1, 439 BGB K könnte gegen V ein Anspruch auf die Behandlung des Hundes gegen die Wurmerkrankung aus §§ 437 Nr. 1, 439 BGB zustehen. Ein Nacherfüllungsanspruch - hier in Form der Män-gelbeseitigung - setzt voraus, dass zwischen den Beteiligten ein Kaufvertrag besteht, ein Mangel gegeben ist, der, wenn es sich um einen Sachmangel handelt, auch schon bei Ge-fahrübergang vorgelegen haben muss, und der Anspruch nicht ausgeschlossen ist. 1. V und K haben einen Kaufvertrag über den Welpen abgeschlossen. 2. Fraglich ist, ob es sich bei der Wurmerkrankung des Welpen um einen Sachmangel handelt. a) Waldemar ist keine Sache, § 90 a S. 1 BGB. Auf Tiere sind aber gemäß § 90 a S. 3 BGB, soweit keine Sondervorschriften existieren, die für Sachen geltenden Regelungen und damit auch die §§ 434 ff. BGB anwendbar.
b)Ein Sachmangel im Sinne des § 434 BGB liegt vor, wenn die Kaufsache nicht die Beschaffenheit hat, die sie haben soll. Gemäß § 434 Abs. 1 S. 1 BGB kommt es dabei in erster Linie auf die Abweichung von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit an. V und K haben über den Gesundheitszustand des Welpen keine Vereinbarung getroffen. Da eine vorübergehende Erkrankung auch nicht die Eignung des Tieres für den vertraglich vorausgesetzten Verwendungszweck beeinträchtigt (vgl. § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BGB), ist entscheidend, ob die Erkrankung eine Abweichung von der üblichen Beschaffenheit darstellt, vgl. § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB. Der Käufer eines Welpen kann üblicherweise erwarten, dass das Tier gesund ist. Ein Sachmangel liegt damit vor. 3. Problematisch ist, ob das auch schon bei Gefahrübergang, also bei Übergabe (vgl. § 446 BGB), der Fall war, da K die Erkrankung erst vier Wochen nach dem Kauf entdeckte und sich ein Hund jederzeit mit Würmern infizieren kann. Zu berücksichtigen ist, dass alle Welpen aus dem Wurf erkrankt sind. Daher liegt eine gemeinsame Quelle der Erkrankung (etwa Aufnahme von Larven schon im Mutterleib, über die Muttermilch oder durch Auflecken in der Umgebung) auf der Hand. Da die Welpen nur bei V zusammen waren, muss die Erkrankung damit schon aus dieser Zeit stammen und bestand somit schon bei Übergabe. 4. Die Mängelhaftung des K könnte aber durch die von V verwendete Klausel ausgeschlossen sein. Ein Haftungsausschluss ist, wie der Gegenschluss aus § 444 BGB zeigt, grundsätzlich möglich. Allerdings sind, wenn dies durch Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) geschieht, die Sonderregelungen der §§ 305 ff. BGB zu Einbeziehung und Wirksamkeit von AGB zu beachten. a) Gemäß § 305 Abs. 1 BGB liegen AGB vor, wenn für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte
Vertragsbedingungen
verwendet
werden.
V
entnahm
die
Ausschlussklausel einem im Schreibwarengeschäft gekauften Formularvertrag, der zur vielfachen, nämlich mehr als dreimaligen, Verwendung erstellt worden ist. Im Übrigen plante V sogar selbst eine vielfache Verwendung, da er ja vier Hundekaufverträge mit der Klausel erstellte.
b) Die Einbeziehung der Ausschlussklausel in den Vertrag ist erfolgt, da sie in der Vertr...
Similar Free PDFs

Wirtschaftsprivatrecht I
- 18 Pages

I. Architecture, ecriture...I
- 32 Pages
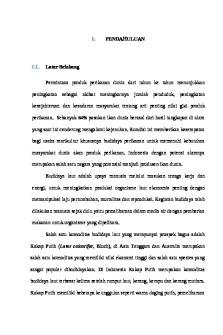
I. PENDAHULUAN I.1
- 35 Pages

PEO I - PEO I
- 24 Pages

Pronomi I - Apuntes Pronombres I
- 25 Pages

Tytan i jego stopy I
- 3 Pages
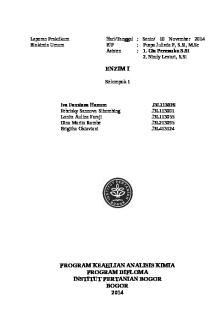
ENZIM I
- 13 Pages

Modul I
- 7 Pages

Teilnehmerhandbuch I
- 21 Pages

Fundicion I
- 14 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu





